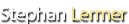Flugzeugabsturz in den französischen Alpen: Der Umgang mit plötzlichem Verlust – und was wirklich zählt
Themen wie Tod und Sterben sind in unserer Gesellschaft weitgehend aus dem Alltag verbannt. Erst Katastrophen wie der kürzliche Absturz des Germanwings-Flugs 4U9525 führen vielen vor Augen, wie plötzlich und unerwartet persönliche Verluste über Menschen hereinbrechen können. Sie werfen Fragen auf, mit denen man sich im Alltag selten beschäftigt.
Nach dem Flugzeugabsturz am 24. März diesen Jahres, bei dem alle 150 Insassen ums Leben kamen, wirkte Deutschland wie gelähmt. Den Angehörigen der Opfer gilt unser aller Mitgefühl für ihren schmerzlichen Verlust. Viele von uns fragen sich gleichzeitig, wie sie selbst mit einer solchen Nachricht umgehen könnten, was Betroffenen wirklich hilft und wie mit dem Beuwsstsein umgegangen werden kann, dass man auch jederzeit selbst urplötzlich mit einer solchen Tragödie konfrontiert sein könnte.
Bewältigung von Trauer und Verlust
Die Trauer ist eine sinnvolle Reaktion auf viele negative Erlebnisse. Dazu gehören neben dem Tod eines geliebten oder nahestehenden Menschen auch Situationen, in denen Abschiede, Trennungen und Enttäuschungen erlebt werden oder in denen einem bewusst wird, dass man ganz Wichtiges unwiderbringlich versäumt hat oder dass man bestimmte Lebensziele nun nie mehr erreichen kann. Psychologen und Psychotherapeuten müssen oft beobachten, dass der Trauer in unserer schnellebigen, sich ständig verändernden Zeit zu wenig Raum und Zeit eingeräumt wird. Gerade das aber wäre zur Bewältigung einer Verlustkrise essenziell wichtig.
Trauer ist individuell
Die Professorin für Psychologie Verena Kast beschrieb bereits 1982 die vier Phasen der Trauer: Während der ersten Phase, der Verleugnung, wollen Betroffene die Tatsache des Verlusts erst einmal einfach nicht wahrhaben, oft befinden sie sich in einem regelrechten Schockzustand, bewegen sich sogar wie in einer Art Trance. Die zweite Phase ist gekennzeichnet von aufbrechenden, teils widersprüchlichen Gefühlen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, körperlichen Beschwerden und dem unablässigen Kreisen der Gedanken um den schmerzlichen Verlust. Das Leben erscheint nun nicht mehr lebenswert. In der dritten Phase, der Phase der langsamen Neuorietierung, werden noch immer starke Stimmungsschwankungen erlitten, Trauer und Hass lassen jedoch langsam nach und sind nicht mehr so intensiv. In der letzten Phase erreichen Trauernde endlich ein neues Gleichgewicht. Trotz der verbleibenden Wehmut und dem Bewusstsein, den erlebten Verlust nie ersetzen oder vergessen zu können, ist ein vertrauensvoller Blick auf die Zukunft möglich, Alltagsaufgaben können wieder bewältigt werden.
Dr. Dr. Herbert Mück, Arzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapeut, warnt dennoch davor, Menschen, die von Verlust betroffen sind, vorzuhalten, wie sie zu trauern haben. Er betont, dass letztlich jeder Mensch individuell trauert. Auch die Forscher James Gilliesa vom Forensic Health Service in Albuquerque und Robert A. Neimeyer, Psychologe an der Universität von Memphis, betonen, dass es verschiedene Strategien der Verlustbewältigung gibt, die prinzipiell gleichberechtigt sind: Manche Trauerprozesse sind gekennzeichnet durch emotionales Durchleben der Trauer, andere durch den Versuch, das Geschehene zu verstehen, wieder andere durch Aktivitäten zur Bewältigung des entstandenen Chaos. Auch beschränktes Weiterfunktionieren bzw. Verdrängen kann eine funktionierende Art der Bewältigung sein. Manche Menschen trauern jahrelang, andere nur Wochen oder Monate. Männer stürzen sich eher auf Aktivitäten, Frauen reagieren mit Rückzug und Appelle um Hilfe. Für Außenstehende ist es wichtig zu akzeptieren, dass keine Form der Trauer nachweislich „besser“ oder „gesünder“ ist.
Den Verlust akzeptieren und aus Trauer lernen
Ein schwerer Verlust fühlt sich für viele Betroffene so an, als haben sie einen Teil ihrer Persönlichkeit verloren. Neue Strategien müssen entwickelt, emotionale Prozesse durchlebt, das eigene Weltbild der neuen Situation angepasst werden. Dies erfordert vor allem Zeit und Ruhe. Außenstehende tun gut daran, Betroffene zu unterstützen, indem sie vor allem deren individuelle Art der Trauer mit Achtung begegnen, sich immer wieder erkundigen, was die Betroffenen möchten und in mit ihnen in Kontakt bleiben.
Auch diese indirekte Art Trauer zu erleben, kann dazu führen, Neues zu lernen: Sie weist auf die Vergänglichkeit des Lebens hin und darauf, dass nichts selbstverständlich ist. Die Beschäftigung mit den Themen Sterben und Tod, die in unserer Gesellschaft geradezu tabuisiert werden, kann dabei helfen herauszufinden, was im Leben wirklich wichtig ist und Wege aufzeigen, sich um diese Dinge oder insbesondere Menschen zu kümmern, solange es noch möglich ist.
Quellen:
Gillies, J., & Neimeyer, R. A. (2006). Loss, grief, and the search for significance: Toward a model of meaning reconstruction in bereavement. Journal of Constructivist Psychology, 19(1), 31-65.
Kast, V. (2015). Trauern: Phasen und Chancen des psychischen Prozesses. Freiburg: Herder.
Mück, H. (2014). Umgang mit Trauer. abgerufen von: http://www.dr-mueck.de/HM_Depression/HM_Trauer.htm 03.04.2014
Kriminalität und Terroranschläge: Glückliche Paarbeziehungen helfen, der Angst zu begegnen
Die Nachrichten über neue Terroranschläge versetzen die Welt in Angst und Schrecken. Seit Jahren untersuchen Psychologen Faktoren, die helfen, mit Bedrohungen umzugehen. Einer dieser Faktoren ist eine glückliche romantische Beziehung.
Nach den Terroranschlägen in Paris wächst die Angst vor weiteren Anschlägen und Kriminalität. Bedrohungsgefühle machen sich breit, sie führen zum Wunsch nach mehr Sicherheit, aber auch zu Vorurteilen und Hass. Das Gefühl der Machtlosigkeit und die Angst vor drohendem Unheil müssen aber – trotz dieser Geschehnisse – nicht unser Leben bestimmen. Sozialpsychologische Studien ermittelten Bewältigungsmechanismen, durch die diese Angst reduziert werden kann.
„Kulturelle Angstpuffer“
Seit fast zwanzig Jahren befassen sich Sozialpsychologen mit typischen Reaktionsmustern, die Menschen entwickeln, um mit Todesangst und dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit umzugehen. Die Terror-Management-Theorie von S. Solomon, J. Greenberg und T. Pyszczynski postuliert zwei Faktoren, durch die das Bewusstwerden der eigenen Sterblichkeit und die dadurch entstehende lähmende Angst besiegt werden kann:
Zum einen schaffen soziale Normen, höherer Sinn oder Transzendenz – kurz: die kulturelle Weltanschauung – eine Struktur und Wertestandards, die uns ein Gefühl von Sicherheit geben.
Der Glaube an diese kulturellen Wertestandards und die entsprechende Lebensführung können zum zweiten, dem emotionalen Faktor der Selbsterhaltung führen: dem eigenen Selbstwert.
Glückliche Paarbeziehungen als weitere „Angstpuffer“
Eine neuere Studie der israelischen Psychologen V. Florian, M. Mikulincer und G. Hirschberger erweitert die Terror-Management-Theorie um einen weiteren Faktor: Sie entdeckten die Angst reduzierende Wirkung romantischer Beziehungen.
Zum einen stellten sie fest, dass das Bewusstwerden der eigenen Sterblichkeit dazu führt, dass auch die Bindung zum/zur eigenen PartnerIn als enger empfunden wird. Andererseits reduzierten Gedanken an die enge Bindung zum/zur PartnerIn die Angst vor dem Tod. Außerdem stellten die Wissenschaftler fest, dass durch das Nachdenken über Partnerschaftsprobleme Gedanken an den Tod bewusster werden als das Nachdeken über z.B. akademische Probleme.
Eine innige und glückliche Partnerschaft hat also eine schützende Wirkung gegen existentielle Ängste.
Freiheit findet im Kopf statt
Der schweizer Autor Bernhard Steiner sagte: „Freiheit findet zur Hauptsache in unserem Kopf statt.“ Nach dem Lesen der obigen Studie möchte man dieses Zitat ergänzen: „und im Herzen“.
Quellen:
Pyszczynski, T., Greenberg, J., & Solomon, S. (1999). A dual-process model of defense against conscious and unconscious death-related thoughts: An extension of terror management theory. Psychological Review, 106, 835–845.
Florian, V., Mikulincer, M., & Hirschberger, G. (2002). The anxiety-buffering function of close relationships: evidence that relationship commitment acts as a terror management mechanism. Journal of personality and social psychology, 82(4), 527.
Dr. Lermer erklärt Serienhit „Under The Dome“ in der tz
Auf ProSieben startet a m Mittwoch die US-Mystery-Serie „Under The Dome“ nach einer Vorlage von Stephen King. Ein Psychologe erklärt der tz, wie viel an dem Grauen unter der Kuppel tatsächlich real ist.
m Mittwoch die US-Mystery-Serie „Under The Dome“ nach einer Vorlage von Stephen King. Ein Psychologe erklärt der tz, wie viel an dem Grauen unter der Kuppel tatsächlich real ist.
Das Horrorszenario – ein kleines Städtchen, abgeschnitten von der Außenwelt
Wer Spannung liebt, kommt am Mittwoch auf seine Kosten: Pro7 startet um 20.15 Uhr die brandneue US-Mystery-Serie „Under The Dome“ von Starautor Stephen King und Steven Spielbergs Produktionsfirma Amblin Television als Deutschlandpremiere. In den USA lief die Serie bereits im Juni an und war mit 13,5 Millionen Zuschauern der erfolgreichste Sommer-Serien-Start seit 1992. Nicht ohne Grund, die Story ist fantastisch!
Ein Flugzeug explodiert am Himmel, auf der Weide wird eine Kuh von einer unsichtbaren Klinge zerteilt, und wie aus dem Nichts stülpt sich eine riesige gläserne Kuppel über die Kleinstand Chester’s Mill in Neuengland. Alles sieht aus wie immer, und doch ist nichts wie zuvor. Die Bewohner sind von der Außenwelt abgeschnitten, müssen damit zurechtkommen, dass die Vorräte zur Neige gehen und der Überlebenskampf beginnt.
Warum ist „Under The Dome“ so spannend?
Stephan Lermer: Stephen Kings geniale Idee setzt an der Basis an, an der Angst des Menschen vor dem Tod. Der Mensch hat als evolutionäres Programm den Trieb, zu überleben. Besser als jedes Navigationsgerät hilft ihm dabei der menschliche Orientierungssinn. Wenn wir uns nicht mehr orientieren können, weil unser ganzes System ausgehebelt ist, fühlen wir uns im wahrsten Wortsinn wie im falschen Film. Weil wir nicht mehr der Regisseur unserer Lebensführung sind.
Es ist ja auch tatsächlich eine schreckliche Vorstellung, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein.
Lermer: Die Situation ist vergleichbar mit der Belagerung einer Festung. Schon im Mittelalter folgte man dabei einem klassischen Muster: Einkreisen und warten, bis den Belagerten die Lebensmittel ausgehen. Der Mensch hat drei Grundbedürfnisse: das nach Autonomie, also Freiheit. Zweitens will der Mensch seine Kompetenzen entfalten, also zeigen können, was er kann. Drittens möchten wir uns eingebunden fühlen und dazugehören. Wenn das alles nicht mehr geht, sind wir sozusagen als Individuen aufgelöst.
Ist so ein Ausnahmezustand besonders schlimm, wenn man gar nicht weiß, wer der Feind ist?
Lermer: Ja. Das Grausamste ist der unsichtbare Feind. Er ist nicht kalkulierbar und bietet gigantische Projektionsflächen. Man kann sich unendlich viele schreckliche Dinge vorstellen.
Warum werden die Menschen in „Under The Dome“ so unberechenbar?
Lermer: Das Wort Persona heißt übersetzt Maske, und diese lassen die Menschen unter extremer Ängstigung fallen. Dann zeigt sich der wahre Charakter, ebenso wie nach einem Lottogewinn. Die einen lassen die Sau raus, die anderen werden sozial – unter der unsichtbaren Glocke werden die einen zu Plünderern, andere übernehmen soziale Verantwortung. Die einen sparen, um möglichst lange zu überleben, die anderen essen und trinken, als gebe es kein Morgen. Diese verschiedenen Verhaltensweisen zeigen Menschen in jeder von außen erzeugten Zwangsgemeinschaft, man denke an Grubenunglücke oder andere eingeschlossene Gruppen.
Also sind die Reaktionen der Menschen in der Serie ganz normal?
Lermer: Ja, tatsächlich. Es gibt in Zwangsgemeinschaften immer vier Positionen: Das Alphatier ist der Machthaber. Der hat einen engsten Kreis um sich, seine Direktoren oder Minister. Dann gibt es drittens das Volk, das geführt werden will. An vierter Stelle steht die Opposition, Menschen, die rebellieren. Das gibt es in jeder Schulklasse, in jeder Firma, in jedem Land und fast in jedem Roman.
Interview mit Susanne Sasse; Originalartikel ist auf der Seite der tz abrufbar.
Wer soll die OP-Musik auswählen – Arzt oder Patient? Hier die Antwort:
Lediglich Flüstern, Murmeln, Besteck- und Gerätegeräusche im OP sind Vergangenheit. Längst weiß man: Musik entspannt die Patienten und reduziert die Angst bei Operationen und anderen Eingriffen.
Einige Ärzte der Maria-Hilf-Kliniken in Mönchengladbach wollten es genau wissen. Sie untersuchten, inwiefern es eine Rolle spielt, welcher Musikgeschmack ertönt, also ob der Arzt die Musik bestimmt oder der Patient auswählen darf.
200 Patienten hörten bei den Herzkatheter-Untersuchungen musikalische Begleitung. Dabei wurden sie in zwei Gruppen aufgeteilt: 100 Patienten durften selbst zwischen Klassik, Pop und Jazz oder aber gar keiner Musik entscheiden. Bei den Untersuchungen der anderen 100 Patienten wurde diejenige Musik abgespielt, für die sich der Arzt entschieden hatte.
Insgesamt wurde deutlich, dass sowohl Angst als auch Blutdruck geringer waren bei Patiente mit Musik im Vergleich zu denen, die sich für gar keine Musik entschieden hatten. Auffällig war aber, dass Angst und Unruhe bei denjenigen Patienten noch weniger ausgeprägt waren, bei denen der Arzt die Entscheidung über die Musik übernommen hatte. Hier war der Effekt bei den Musikrichtungen Klassik und Jazz sogar besonders ausgeprägt.
Zur Erklärung führten die Wissenschaftler an, die Patienten gäben in der Klinik die Verantwortung generell gerne komplett ab. Außerdem müssten sie sich so keine Gedanken machen, ob die Wahl wohl auch dem Arzt zusage – dem sie ja schließlich ausgeliefert sind.
Quelle: Goertz, Wolfram et al.(2011). Music in the cath lab: who should select it? In: Clinical Research in Cardiology – CLIN RES CARDIOL, vol. 100, no. 5, pp. 395-402, 2011
Die Gründerpersönlichkeit
Selbständigkeit ist in Deutschland keine Selbstverständlichkeit: Nur etwa 10,5% aller erwerbstätigen Deutschen sind selbständig. Vergleicht man diese Zahl mit dem Schnitt anderer Länder, so fragt man sich, wie die deutsche Gesellschaft aus der Gründermentalität der Nachkriegsjahre (durchschnittlich 30% Neugründungen in den 50er Jahren) in eine solche „unternehmerische Lethargie“ fallen konnte: Deutschland nimmt von 20 untersuchten Industrienationen gerade einmal den 15. Platz ein. Abgehängt zum Beispiel von der Schweiz, den Niederlanden oder Großbritannien.
Ganz zu schweigen von den USA. Und beim Vergleich mit dem transatlantischen „großen Bruder“ sieht man auch sehr schön, warum das so ist: „Hinfallen ist dort nicht schlimm, [in Deutschland] kommt es einer Katastrophe gleich“ analysiert Marie-Dorothee Burandt, Co-Autorin einer groß angelegten Studie des BDP (Berufsverband deutscher Psychologen und Psychologinnen).
Laut der Studie ist es die Angst vor dem Scheitern, das vielen potentiellen Gründern die Selbständigkeit verwehrt: „Wer in Deutschland als Selbständiger scheitert, steht nur schwer wieder auf. Das Bild, nichts zu taugen, es nicht geschafft zu haben, haftet an einem wie ein Makel.“ Unternehmensgründer sind in der Regel dadurch motiviert, etwas Neues zu leisten, sich durchzusetzen und sich von der Gesellschaft abzuheben. Wenn allerdings die Gesellschaft die Werte Freiheit, Durchsetzungsstärke und Unabhängigkeit nicht schätzt und Unternehmer immer häufiger mit Abzockern gleichgesetzt werden, will das schließlich keiner mehr ernsthaft anstreben.
Deshalb rät Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages: „Wir brauchen […] eine deutschlandweite Offensive für das Verständnis von Unternehmertum.“
Die Studie des BDP berichtet allerdings auch von positiven Aspekten: Von der idealen Gründerpersönlichkeit und von der „Ausbildung“ zum Unternehmensgründer durch Bildung und Training. Wird nächste Woche fortgesetzt.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: http://www.bdponline.de/web/newsletter/2010/05.html
Autsch! Verlust von Geld kann schmerzhaft sein
Wer sich noch an Walt Disney’s Lustige Taschenbücher erinnert, hat jetzt vielleicht den guten alten Dagobert Duck vor Augen: Nach finanziellen Verlusten ist der wahlweise erst einmal ‚krank‘, zieht sich zurück oder krümmt sich, als ob er Schmerzen hätte.
Was im Comic überzogen dargestellt ist, kommt in milderer Form in der Realität allerdings auch vor. Wissenschaftler vom University College London beobachteten Versuchsteilnehmer, die in einem Wett-Spiel Geld verloren. Sie benutzten dazu fMRI (funktionelle Magnetresonanztomographie). Mit diesem röntgenähnlichen Verfahren konnten Sie den Gehirnen der Probanden bei der ‚Trauerarbeit“ zusehen.
Sobald die Teilnehmer einen Verlust erlitten hatten oder einen drohenden Verlust kommen sahen, wurden Hirnregionen aktiv, die auch bei körperlichem Schmerz und psychischer Trauer vermittelnd eingreifen. Diese Areale sitzen tief im Gehirn und erkennen Schmerz und Verlust bereits bevor diese Zustände uns überhaupt als Gefühle bewusst werden, ja sogar bevor wir überhaupt einen Verlust erleiden. Die Forscher um Ben Seymour vermuten deshalb, dass wir Schmerz und Angst in diesem frühen Zustand unterdrücken können, so dass wir noch handlungsfähig bleiben. Eventuell sogar, um drohenden Verlust zu vermeiden.
In weiteren Studien erhoffen sich die Forscher Aufschlüsse über die Entstehung von Spielsucht und unkontrollierbarer Angst vor drohenden Verlusten.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Ben Seymour, Nathaniel Daw, Peter Dayan, Tania Singer, Ray Dolan
(2007). Differential encoding of losses and gains in the human striatum.
Journal of Neuroscience. 27(18):4826-31.