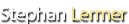Anderen die Schuld zuschieben… ist ansteckend!
Anderen die Schuld für eigene Versäumnisse zuzuschieben, ist einfach, aber langfristig schädlich. Zudem ist dieses Verhalten ansteckender als die Schweinegrippe und kann das Organisationsklima innerhalb kürzester Zeit nachhaltig verschlechtern.
„Schuldzuweisungen erschaffen eine Kultur der Angst“ sagt Prof. Dr. Nathanael Fast, Psychologe an der University of Southern California in Los Angeles. In einigen Experimenten untersuchte er Dynamik und Auswirkungen von öffentlichen Schuldzuweisungen und öffentlicher (unberechtigter) Kritik. Er stellte dabei fest, dass Menschen sich schneller von schlechten Beispielen anstecken lassen, als sie selbst zugeben würden:
„Wenn wir beobachten, wie andere ihr Ego schützen, indem sie andere angreifen und ihnen die Schuld für Fehler zuschieben, beginnen wir rasch selbst damit, solche Verteidigungsstrategien zu entwickeln. Wenn wir dann unser Selbstbild schützen, indem wir anderen die Schuld geben, fühlt sich das in dem Moment gut an.“ Langfristig nähme das Ego jedoch Schaden, meint Fast. Genau wie die eigene Reputation, die Arbeitszufriedenheit und die Leistung ganzer Arbeitsgruppen und Organisationen.
Was aber tun, wenn man sein Ego bedroht sieht und die Schuld gerechterweise auf andere Schultern verteilen will?
Zunächst rät Fast zur alten Weisheit, die Schuldfrage erst einmal unter vier Augen zu klären – damit kein Außenstehender sich das Verhalten von Schuldzuweisungen und Aggression ‚abschauen‘ kann: „Loben Sie in aller Öffentlichkeit, kritisieren Sie unter vier Augen.“ Oder etablieren Sie eine Kultur, in der Fehler nicht nur toleriert, sondern als Chance zu Verbesserung und persönlicher Entwicklung wahrgenommen werden.
Fast zeigt in seinen Experimenten auch, dass ein hohes Selbstwertgefühl vor Schuldzuweisungen schützt: Versuchsteilnehmer, deren Selbstvertrauen durch ein kurzes Training gestärkt worden war, zeigten sich weitaus weniger anfällig für Schuldzuweisungen und sorgten in der Regel für ein positiveres Klima und produktivere Arbeitsbedingungen in ihrem Umfeld.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: www.eurekalert.org/pub_releases/2009-11/uosc-sbi111909.php
Schweiß lass nach -warum schwitzen wir, wenn wir Angst haben?
Schon einmal vor einem wichtigen Gespräch klamme, schwitzige Hände gehabt? Den Schweiß auf der Stirn gespürt oder den eigenen Angstschweiß unangenehmer Weise gerochen?
Nicht alle Menschen schwitzen in unangenehmen, peinlichen, aufregenden oder gefährlichen Situationen gleichermaßen, aber die große Mehrheit tut es – und bemerkt es auch selbst.
Warum aber schwitzen wir in gefährlichen Situationen? Dass uns der Angstschweiß ausbricht, hat vor allem zwei Gründe:
- Evolutionär gesehen bereitet uns Schwitzen optimal auf Kampf und Flucht vor. Er verschafft uns das gewisse Etwas an Extra-Energie, damit wir schwierige Situationen bestmöglich durchstehen können – oder uns schnellst möglich daraus entfernen können. Wenn wir nämlich kämpfen, fliehen oder dauerhaft Höchstleistungen bringen müssen, heizt sich der Körper automatisch auf. Und Schweiß ist die natürliche Kühlflüssigkeit des Körpers. Dass schon vor wichtigen und gefährlichen Situationen Schweiß ausgeschüttet wird, liegt an einer gelernten Reaktion: Haben wir eine ähnliche Gefahrensituation schon einmal erlebt, prägen sich die Anzeichen für diese Situation unauslöschbar in unserem Gedächtnis ein. Unser Gedächtnis steuert in der wieder kehrenden Situation dann nicht nur unsere bewussten Gedanken, sondern auch unsere unbewussten Reaktionen – so auch die Schweißbildung. Gutes Beispiel: Das Wartezimmer beim Zahnarzt. Nirgendwo wird ähnlich viel Angstschweiß vergossen, obwohl eigentlich noch gar nichts passiert ist.
- Angstschweiß warnt andere Menschen in unserer Umgebung vor Gefahr. Jedes Kind weiß schon, dass Hunde Angstschweiß wahrnehmen können und entsprechend reagieren. Menschen können und tun das auch. Die Psychologin Prof. Dr. Bettina Pause von der Universität Düsseldorf untersuchte die Hirnaktivität von freiwilligen Versuchsteilnehmern mittels funktioneller Magnetresonanztomografie. Dabei mussten Ihre Probanden Schweißproben schnüffeln – die Hälfte davon waren in ‚Angstschweiß‘ getränkt, die andere Hälfte in ‚Anstrengungsschweiß‘. Das Ergebnis: Angstschweiß aktivierte in viel stärkerem Maße Hirnregionen, die für soziale Emotionen wie Mitgefühl verantwortlich waren. Nimmt man also Angstschweiß wahr, kann man unmittelbar fühlen, dass etwas nicht stimmt und ist gewarnt. Das zeigt auch eine Studie der Psychologin Denise Chen von der University of Houston. Deren Versuchsteilnehmer sahen sich teils Horrorfilme an, teils Dokumentarfilme. Danach gab man Studenten die Schweißproben dieser Teilnehmer zum Schnüffeln und ließ sie Wortpaare auf ihre Zusammengehörigkeit hin beurteilen. Die Hälfte dieser Wortpaare bestand aus normaler Weise angstbesetzten Wörtern wie ‚Tod‘ und ‚Waffe‘. Genau bei diesen Wörtern gelang die Zuordnung viel schneller, wenn die Studenten den Angstschweiß anderer Versuchsteilnehmer rochen. Durch den Schweiß waren sie also optimal auf die Erkennung von Gefahrensituationen vorbereitet.
Fazit: Angstschweiß ist eine natürliche und ursprünglich überlebenswichtige Reaktion unseres Körpers. Bevor man also den Schweiß mittels einschlägiger Präparate direkt unterdrückt, sollte man zunächst das Übel bei der Wurzel packen und sich fragen: Wovor habe ich eigentlich Angst? Was an dieser Angstsituation stört mich wirklich und was kann ich verhindern? Wie kann ich mich selbst ruhiger und unentspannter machen, damit erstens keine Angst und zweitens in der Folge kein Schweiß entsteht? Was auch immer uns zum Schwitzen bringt: Wir müssen es erkennen und bewältigen. Damit steigt auch unsere Lebensqualität.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Pause, B. M., Ohrt, A., Prehn, A., Sojka, B. & Ferstl, R. (2008). Chemosensory communication of anxiety. Journal of Psychophysiology.
Depressiv aus Nächstenliebe?
Eine wohltätige Spende hilft in der Regel nicht nur dem Empfänger, sondern auch dem Geber.
Während der Empfänger von der materiellen Unterstützung profitiert, genießt der Spender das Gefühl, Hilfe geleistet zu haben – Selbstwert und Selbstwirksamkeit werden gesteigert. Das schafft kurzfristig positive Gefühle und bildet langfristig eine gute Grundlage für Sinnempfinden und ein reiches Sozialleben.
Psychologische und soziologische Forschung bescheinigt Menschen, die sich derart altruistisch verhaltenin der Regel auch ein glücklicheres Leben. So weit, so gut. Ein diskussionswürdiges Ergebnis lieferte jetzt allerdings eine Studie mit Daten des National Survey of Midlife Development in the U.S.: Regelmäßige Spender haben ein 2,6-faches Risiko, an Depressionen zu erkranken.
Ein möglicher Grund für die die Aufsehen erregenden Daten ist, dass bereits vor der Depression bestehende Schuldgefühle die ‚Anfälligkeit‘ für Spendenbereitschaft erhöhen. Damit wäre die Spendenbereitschaft ein ‚Symptom‘ einer depressiven Grunderkrankung, das auftreten kann, aber nicht muss. Denkbar wäre auch , dass der verringerte Selbstwert, der oft mit depressiven Erkrankungen einhergeht, das Ablehnen von Spendenanfragen verhindert. Oder dass das Spenden eine Art ‚Eigentherapie‘ darstellt, die depressive Schuldgefühle verringern kann.
Eine wichtiges Manko der Studie ist allerdings, dass die Forscher nur Geldspender untersuchten. Direkte, aktive Hilfe sowie emotionale Zuwendung zu Bedürftigen wurden nicht in die Analyse miteinbezogen.
Hier zeigt die psychologische Forschung allerdings konsistent, dass tätige Hilfe und emotionale Unterstützung vor Depressionen und Ängsten schützen. Wie unser Blog-Beitrag vom 3.3.09 zeigt, haben auch Geldspenden normaler Weise langfristige positive Folgen für den Spender. Die Forschung ist in diesem Gebiet wohl etwas inkonsistent.
Vielleicht sollte man vor der nächsten Geldspende einfach kurz seine Motive hinterfragen. Hier kann eine Visualisierung der Ergebnisse nützlich sein: Stellen Sie sich vor, was mit dem Geld gemacht wird, wo es hinkommt, wer es erhält. Wenn Sie dabei Freude und Mitgefühl empfinden: Füllen Sie den Spendentopf. Falls Sie Erleichterung oder Schuld verspüren: Kaufen Sie sich selbst etwas Schönes und nehmen Sie sich die Zeit, aktiv tätig und unmittelbar zu helfen. Denn das schützt vor Depressionen, so viel ist wenigstens sicher!
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Fujiwara, T. et al (2009). Is altruistic behavior associated with major depression onset? PLoS ONE, 4(2), e4557
Angst kommt vor Zuneigung – zumindest zeitlich gesehen
Innerhalb von Millisekunden erkennen Sie die Gefahr.
Sie wollen vom Bürgersteig über die Straße auf die andere Seite. Dafür müssen Sie zunächst über den Radweg. Sie unterhalten sich angeregt mit Ihrer Begleiterin und blicken dabei in ihr Gesicht. Obwohl Sie den Radweg kurz vorher auf Radfahrer gecheckt haben, schrecken Sie plötzlich zurück. Keine Sekunde später bemerken Sie den erschrockenen Gesichtsausdruck Ihrer Begleiterin und im gleichen Moment fährt etwas ganz nahe an Ihnen vorbei (und beschimpft Sie vermutlich). Wo kam der her? Gut reagiert.
Wir bemerken Anzeichen von Gefahr im Gesicht unseres Gegenübers, bevor uns diese bewusst werden – und zwar in weniger als 40 Millisekunden. Diese Schnelligkeit der Verarbeitung von negativer Mimik und Gestik verschafft uns vermutlich einen evolutionären Vorteil: Auf Bedrohungen kann sofort und „intuitiv“, also ohne Einschalten des Bewusstseins reagiert werden. Die Amygdala, eine Hirnregion, die auf das Erkennen negativer Emotionen spezialisiert ist, leitet Sinneswahrnehmungen quasi gleichzeitig an unsere Beine und die bewusstseinszugänglichen Gehirnregionen des Kortex weiter, die erst dann anschließend eine (vergleichsweise langwierige) Bewertung der Gefahrensituation vornehmen.
Man kann auch sagen: Wir sind quasi evolutionär darauf programmiert, primär negative Emotionen erkennen und schnell verarbeiten zu wollen, weil sie überlebensrelevant sein könnten. Angst wird deutlich schneller verarbeitet als Freude, Zorn wird schneller in Handlungen umgesetzt als Zuneigung. In gleicher Weise ist auch unsere Aufmerksamkeit darauf genetisch programmiert, Zeichen für Unmut, Trauer, Gefahr und schlechte Stimmung aus der Umwelt herauszuschälen. Menschen nutzen das unbewußt teilweise sogar gezielt aus, indem sie sich durch Jammern oder Lärm die Aufmerksamkeit anderer sichern. Und, negative Gefühle sind ansteckend: In einer gespannten Atmosphäre ist man „unwillkürlich“ auch angespannter. Jemand, der ständig jammert, „zieht uns runter“, obwohl wir vielleicht in guter Stimmung waren. Wenn wir es zulassen.
i.A. Dr. Stephan Lermer
Quelle: Yang, E. (2008). Fearful expressions gain preferential access to awareness during continous flash suppression. Emotion, 7 (4), pp. 682-686