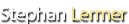Wer soll die OP-Musik auswählen – Arzt oder Patient? Hier die Antwort:
Lediglich Flüstern, Murmeln, Besteck- und Gerätegeräusche im OP sind Vergangenheit. Längst weiß man: Musik entspannt die Patienten und reduziert die Angst bei Operationen und anderen Eingriffen.
Einige Ärzte der Maria-Hilf-Kliniken in Mönchengladbach wollten es genau wissen. Sie untersuchten, inwiefern es eine Rolle spielt, welcher Musikgeschmack ertönt, also ob der Arzt die Musik bestimmt oder der Patient auswählen darf.
200 Patienten hörten bei den Herzkatheter-Untersuchungen musikalische Begleitung. Dabei wurden sie in zwei Gruppen aufgeteilt: 100 Patienten durften selbst zwischen Klassik, Pop und Jazz oder aber gar keiner Musik entscheiden. Bei den Untersuchungen der anderen 100 Patienten wurde diejenige Musik abgespielt, für die sich der Arzt entschieden hatte.
Insgesamt wurde deutlich, dass sowohl Angst als auch Blutdruck geringer waren bei Patiente mit Musik im Vergleich zu denen, die sich für gar keine Musik entschieden hatten. Auffällig war aber, dass Angst und Unruhe bei denjenigen Patienten noch weniger ausgeprägt waren, bei denen der Arzt die Entscheidung über die Musik übernommen hatte. Hier war der Effekt bei den Musikrichtungen Klassik und Jazz sogar besonders ausgeprägt.
Zur Erklärung führten die Wissenschaftler an, die Patienten gäben in der Klinik die Verantwortung generell gerne komplett ab. Außerdem müssten sie sich so keine Gedanken machen, ob die Wahl wohl auch dem Arzt zusage – dem sie ja schließlich ausgeliefert sind.
Quelle: Goertz, Wolfram et al.(2011). Music in the cath lab: who should select it? In: Clinical Research in Cardiology – CLIN RES CARDIOL, vol. 100, no. 5, pp. 395-402, 2011
Coaching: Psychohygiene rechnet sich – denn trübsinnige Stimmung führt zu kurzsichtigen Entscheidungen
Die klassische Coaching-Empfehlung von Dr.Lermer, wichtige Entscheidungen nicht im Stimmungstief, sondern im Plus-Zustand zu treffen, wurde wieder einmal wissenschaftlich bestätigt. Die Harvard-Professorin Jenniver Lerner und ihr Team konnten belegen, wie eine traurige Stimmunslage direkt zu negativ irrationalen Entscheidungen führt. In ihrem Experiment stellte sie 600 Versuchspersonen die klassiche Frage, ob sie lieber einen kleineren Geldbetrag von 25 Dollar sofort oder 85 Dollar wählen würden, wobei es den größeren Geldbetrag nicht sofort, sondern erst in ein paar Wochen gibt. Dann wurden den Subgruppen a) ein trauriger Film b) ein ekliger und c) gar kein Film dargeboten. Signifikant unterschiedlich zu den anderen Gruppen entschieden sich die Betrachter a) des traurigen Films für das schnelle kleine Geld, und damit für die schlechtere Variante.
Fazit: Traurigkeit schlägt Hoffung und Vertrauen und (ver-)führt zu kursichtigen Entscheidungen. Lerner nenn das Phänomen myopic misery. Unsere Empfehlung daraus: In Situationen trauriger Stimmung entweder die Ursachen dafür auflösen, sich ablenken oder abwarten („wait and see“). Und Entscheidungen erst wieder dann treffen, wenn man hoffnungsgeladen und voller Vertrauen aufs Gelingen wieder souverän und damit in der Lage ist erfolgreiche Entscheidungen zu treffen.
Quelle: Lerner, Jenniver S., Weber, Elke U., The Financial Costs of Sadness. Psychological Science 2012, 13
Schöner Schein…
Das englische Sprichwort „don’t judge a book by its cover“ (“Bewerte ein Buch nicht nach seinem Einband”) mahnt auf metaphorische Wiese davor, den Wert oder das Innere einer Sache oder Person anhand seines Aussehens zu beurteilen. Dennoch lassen wir uns täglich von der Schönheit verführen und blenden …
Die „what is beautiful – is good“-Theorie beschreibt dieses Phänomen: attraktiven Menschen werden Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschrieben, die mit dem Äußeren nichts zu tun haben. Wir schließen permanent von der äußeren, auf die innere Schönheit.
So wie wir Menschen anhand anderer Eigenschaften und Merkmale schnell einen Stempel aufdrücken, der mit diesem Merkmal nichts zu tun haben muss (z.B. „Dicke sind gemütliche Gesellen“, „Brillenträger sind klug“, „Männer im Anzug sind erfolgreich“), fungiert auch hier der sogenannte „Attraktivitätsstereotyp“ (Henss, 1992) als Wahrnehmungsfilter, um die überaus komplexe Welt um uns herum für sich selbst zu ordnen. Dadurch wird ein Kontrollgefühl evoziert und sogar Handlungsfähigkeit geschaffen. Denn wenn man sein Gegenüber erst einmal „etikettiert“ hat, also einschätzen kann, mit wem man es wohl zu tun hat, dann man kann angemessener reagieren. Alles und jeden aber derart differenziert und in seiner Vielschichtigkeit erfassen zu wollen, würde allerdings unser Wahrnehmungssystem lahm legen. Die Folge: wir würden zu gar nichts mehr kommen. Deshalb ist die Stereotypisierung für den Menschen durchaus funktional, wenn auch nicht immer korrekt und vor allem auch nicht immer fair (Segal-Caspi, Roccas, & Sagiv, 2012).
Schon 1972 konnten die Psychologen Dion, Walster und Berscheid (1972) zeigen, dass attraktive Kinder in der Schule weniger oft bestraft werden, attraktive Studenten bessere Noten bekommen, ja selbst die Berufschancen stehen für attraktive Menschen besser. In Ihrer Übersichtsarbeit zeigte Judith Langlois und ihr Forscherteam (2000), dass sowohl attraktive Kinder als auch Erwachsene generell für sozial kompetenter gehalten werden, egal ob in der Schule oder im Berufsleben.
Verblüffender weise schafft diese heuristische Zuschreibung oftmals eine eigene Realität – wirkt somit als selbsterfüllende Prophezeiung: Schönen Menschen werden sozial erwünschte Charakterzüge (Aufgeschlossenheit, Freundlichkeit, Geselligkeit) zugeschrieben, weshalb man diesen Menschen entsprechend offen, freundlich und wohlwollend gegenübertritt. Wie es in den Wald reinschallt, so schallt es heraus. Als Folge davon reagieren die „Schönen“ tatsächlich so, wie es dem „Attraktivitätsstereotyp“ nach erwartet wird.
Dies konnte Snyder, Berscheid und Tanke (1977) in ihrem klassischen psychologischen Experiment aufgezeigen: Sie ließen 51 männliche und 51 weibliche Studenten/Innen ein zehnminütiges Telefonat führen. Das Gesprächspaar war sich jeweils unbekannt. Die männlichen Probanden erhielten einen kurzen Fragebogen der Telefonpartnerin, sowie ein Foto, welches angeblich die Dame am anderen Ende der Leitung zeigen sollte. Tatsächlich waren es anderen Frauen, die zuvor nach Attraktivität beurteilt worden waren. Die Hälfte der männlichen Studienteilnehmer bekam Fotos von sehr attraktiven, die andere Hälfte von sehr unattraktiven Frauen.
Vor dem Telefonat gaben die Männer ihre Erwartung bzgl. Intelligenz, physische Attraktivität und Freundlichkeit der Telefonpartnerin an. Ganz der „what is beautiful – is good“-Theorie folgend, erwarteten die Männer, denen ein attraktives Foto zugespielt wurde, eine kontaktfreudige, humorvolle und aufgeschlossene Frau am Hörer. Dementsprechend negativ war die Erwartung bei den Männern mit den unattraktiven Fotos.
Auch die Gesprächsfrequenz wurde von den Psychologen ausgewertet. Das Ergebnis bestätigte die Annahme der „selbsterfüllenden Prophezeiung“: Frauen, die vom männlichen Telefonpartner für attraktiv gehalten wurden, wirkten selbstbewusster, schienen das Gespräch mehr zu genießen und den Gesprächspartner zu mögen. Genau das gegenteilige Bild zeigte sich bei den Frauen, die für unattraktiv gehalten wurden. Darüber hinaus wirkten auch die Männer, die annahmen, mit der attraktiven Frau zu telefonieren, auf die bewertenden Psychologen attraktiver und selbstbewusster.
Segal-Caspi, Roccas, & Sagiv (2012) von der israelischen Open Universität gingen in einem weiterem Experiment zu diesem Phänomen der Frage nach, ob die „Schönen“ tatsächlich jene Eigenschaften und Werte zeigten, die ihnen zugschrieben wurden.
118 weibliche Probanden wurden dabei gefilmt, wie sie den Wetterbericht vorlasen und danach den Raum verließen. Dieses Video wurde von Männern und Frauen hinsichtlich Attraktivität (Gesicht, Körper, Kleidung), innerer Werte und Eigenschaften bewertet. Auch in dieser Studie wurden die körperlich attraktiven Frauen als liebenswürdiger, offenherziger, extravertierter, gewissenhafter und emotional stabiler bewertet.
Interessanterweise gab es gar keinen Zusammenhang dieser attraktivitätsbasierten Einschätzung mit den Selbstangaben der Frauen über ihre Eigenschaften und Wertvorstellungen. Der schöne Schein trügt eben manchmal…
Quellen:
Dion, K., Berscheid, E. & Walster, E. (1972). What is beautiful is good. Journal of Personality and Social Psychology, 24, 285-90.
Henss, R. (1992). „Spieglein, Spieglein an der Wand . . .“ Geschlecht, Alter und physische Attraktivita [„Mirror, mirror on the wall …“ Sex, age, and physical attractiveness]. Weinheim, Germany: Psychologie Verlags Union.
Snyder, M., Tanke, E. & Bersheid, E. (1977). Social perception and interpersonal behavior: On the self-fulfilling nature of social stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 656-666.
Judith Langlois et. al (2000). Maxims or Myths of Beauty? A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin, 126, 390-423.
Segal-Caspi, L, Roccas, S. & Sagiv, L. (2012). Don’t Judge a Book by Its Cover, Revisited: Perceived and Reported Traits and Values of Attractive Women. Psychological Science, 23, 1112-1116.
1 Menschen töten um 5 zu retten?
Ein Gedankenexperiment:
Sie beobachten eine führerlose Straßenbahn, die mit hoher Geschwindigkeit direkt auf fünf Gleisarbeiter zufährt. Da die Männer auf den Schienen mit Ohrenschützern arbeiten, bemerken sie die drohende Gefahr nicht. Sie aber wiederum stehen genau an der alles entscheidenden Weiche, und Sie hätten jetzt auch gerade noch Zeit genug um die Tram, die jetzt zur tödlichen Waffe zu mutieren droht, lebensrettend umzuleiten – und damit die Männer vor ihrem sicheren Tod zu bewahren. Bis dahin keine schwierige Entscheidungslage.
Aber: Würden Sie die Gleise auch umleiten, wenn Ihre Entscheidung einen einzelnen Arbeiter töten würde, der sich fatalerweise gerade auf dem umgeleiteten Gleis aufhält?
Dieses moralische Dilemma würden 90% der Befragten dahin gehend beantworten, dass sie lieber den Tod weniger in Kauf nehmen, um damit das Leben vieler zu retten – so die subjektive Einschätzung der Befragten. Eine aktuelle Studie des Evolutionspsychologen Navarette (2011) der Michigan State Universität ging zur Erforschung des sogenannten „Trolley-Problems“ noch einen Schritt weiter. Die knapp 300 Probanden erlebten die Entscheidungssituation computersimuliert mittels 3D-Brille.
Die Hälfte der Gruppe sollte den Knopf zur Gleisumleitung drücken können und damit den Tod einer Person bewußt in Kauf nehmen – es musste also aktiv etwas getan werden. Bei der anderen Hälfte der Probanden war kein Knopfdruck nötig, zumal der Zug schon auf das zweite Gleis mit der Einzelperson zulief. Die Ergebnisse gehen konform mit den subjektiven Einschätzungen früherer Untersuchungen: In der ersten Variante stellten 90 % der Versuchsteilnehmer die Gleise um, um die fünf Personen zu retten. Auch in der zweiten Versuchsanordnung, in welcher die Personen nichts zu tun brauchten, entschieden sich 88 % der Probanden dafür eine Person zu opfern um fünf andere zu retten.
Das „Trolley-Problem“ wurde in vielen Abwandlungen untersucht, unter anderem von Judith Jarvis Thomson, einer Professorin des Massachusetts Institute of Technology. In ihrer Version des „Fetten-Mann-Problems“ spielt das Entscheidungsszenario der entgleisten Straßenbahn auf einer Brücke, anstatt am Weichenstellpunkt. Die einzige Möglichkeit die führerlose Straßenbahn zu stoppen, bestand darin einen großen, schweren Gegenstand von der Brücke auf den Straßenbahnwagen zu werfen. Das einzige zur Verfügung stehende „Objekt“ ist ein dicker Mann. Würde man den dicken Mann stoßen, um die fünf Gleisarbeiter vor dem Tod zu retten?
Jetzt würden die meisten der Befragten mit „nein“ antworten. Die Forscherin Judith Jarvis Thomson meint, dass dies der Unterschied zwischen „töten“ und „sterben lassen“ sei. Wer die Weiche umleitet, handelt zwar aktiv, benutzt aber keinen Menschen als Mittel zum Zweck.
Als Fazit könnte man nun die erfreuliche Erkenntnis ableiten, dass Menschen sehr wohl bereit sind sozial zu handeln, bereit sind Entscheidungen zum Wohl gefährdeter anderer zu treffen, selbst wenn sie diese garnicht kennen. Solange der Preis/das Opfer dafür, also die Verantwortungsübernahme zu Lasten des „es“/des Systems/der Situation geht. So lädt man sich ja keine Schuld auf, sondern minimiert die Opferzahl. Wenn es aber darum geht selbstverantwortlich eine Entscheidung zu treffen, wodurch man schuldig am Mord eines Menschen würde, um fünf anderen das Leben zu retten, dann sagt unser Evolutionsprogramm: Stop. Nichtstun macht einen ja nicht zum Mörder. Ist zwar schade um die fünf Opfer, aber die Schuld lag und liegt ja bei den Betreibern der Starßenbahn. Und – letztlich wäre die Justiz wahrscheinlich sowieso überfordert gewesen, die Komplexität des Geschehens zu begreifen. Somit kann man die Zauderer gut verstehen.
Quelle:
Navarette, C., McDonald, M., Mott, M. & Asher, B. (2011). Virtual morality: emotion and action in a simulated three-dimensional „trolley problem“. Emotion, 12, 364-370.
Jarvis Thomson, J. (1976). Killing, Letting Die, and the Trolley Problem. The Monist, 59, 204-17.
Zwei lohnende Tipps für eine erfüllte Partnerschaft
1. Lernen Sie zu schenken
Eine Blume oder ein Lächeln, einen Brief oder ein Buch. Es kostet nicht viel, etwas zu schenken. Die Freude, die Sie damit erzeugen, ist um vieles größer als der Aufwand, den Sie hatten. Es lohnt sich. Ist gesunder Egoismus also auch Egoismus, nur indirekt? Ja, aber nicht auf Kosten anderer, sondern eine Form von Egoismus, mit der nicht nur Sie, sondern auch der andere auf seine Kosten kommt. Denn es ist genug für alle da.
2. Lernen Sie, sich zu entscheiden
„Wähle und meide mit Bedacht“ heißt eine Lebenssregel aus der Antike. Üben Sie sich darin, sich einmal eine Weile lang bei allen möchlichen Anlässen selbst zu fragen: Fordere ich genug oder zuviel oder zuwenig, kenne ich die jeweils passenden Formen, um mich durchzusetzen, ohne anzuecken oder zu verletzen? Kann ich Liebe, Komplimente und Geschenke annehmen? Kann ich in entscheidenden Augenblicken „ja“ sagen, oder was noch schwieriger ist: kann ich „nein“ sagen?
Achten Sie darauf, was Ihnen nützt und was Ihnen schadet. Fragen Sie sich öfter: Brauche ich das? Will ich das wirklich? Sie haben das Recht dazu, Ihr Leben nach den Antworten auf diese Fragen einzurichten. Dann erst werden Sie Ihrer Selbstverantwortung gerecht.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Lermer, Stephan (1994). Liebe und Lust. Mary Hahn Verlag
Vorsicht! Risikobereitschaft deutlich zurückgegangen
Deutschland geht weniger Risiken ein. Das zeigt eine Studie des Instituts für Demoskopie in Allensbach.
Die Meinungsforscher befragten rund 20.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 14 Jahren nach ihrer Risikobereitschaft. Das Ergebnis: Nur noch 14% der Befragten hielten Risikobereitschaft im Leben für wichtig, gegenüber 29% im Jahr 2000.

Mit dem Alter wird man risikoscheuer (manche sagen: klüger) und so verwundert es nicht, dass immerhin 20% der Unter-30-Jährigen das Risiko nach wie vor lieben und für wichtig halten. Allerdings waren es auch in dieser Generation im Jahre 2000 noch 36%. Die Wirtschaftskrise 2009 hat offenbar viele Menschen vorsichtig gemacht. Dabei braucht es gerade jetzt den Mut, Risiken einzugehen, Entscheidungen zu treffen und neu anzufangen. Deutschland wartet…
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Insitut für Demoskopie Allensbach