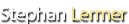Studie zum Umgang mit Sozialen Medien: Macht uns Facebook unglücklich?
Die Nutzung sozialer Medien ist für die meisten Menschen zur täglichen Routine geworden: Facebook, Twitter, Instagram, Xing sind für die meisten so selbstverständlich, dass sie sich ein Leben ohne Vernetzung nicht einmal mehr vorstellen können. Doch wie beeinflusst die Nutzung sozialer Medien unsere Lebensqualität?
Wieviel Einfluss hat die tägliche Nutzung sozialer Medien auf die Lebensqualität?
Dieser Frage ging das dänische Happiness Research Institute in einer groß angelegten experimentellen Studie nach. – Mit erstaunlichen Ergebnissen.
Die Studie
Das Happiness Research Institute mit Sitz in Kopenhagen ist ein unabhängiges Forschungsinstitut, eine Art Denkfabrik, das den Fokus seiner Forschung vollkommen auf Wohlbefinden, Glück und Lebensqualität legt. Ziel der Forscher ist es, Entscheidungsträger über Ursachen und Wirkungen von Glück zu informieren, das subjektive Wohlbefinden zum Gegenstand öffentlicher Debatten zu machen und so die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen.
Für ihr „Facebook-Experiment“ wurden über 1.000 Menschen in Dänemark nach ihren Gewohnheiten bezüglich der Nutzung sozialer Medien sowie über ihre Lebenszufriedenheit befragt. Anschließend wurden die StudienteilnehmerInnen zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe sollte Facebook weiterhin so nutzen wie gewohnt, die zweite Gruppe jedoch wurde aufgefordert, Facebook eine ganze Woche lang gar nicht zu benutzen. Nach dieser Woche wurden alle TeilnehmerInnen erneut gefragt, wie hoch sie ihre Lebensqualität einschätzten.
Die Ergebnisse der Studie
Die Ergebnisse des Experiments sind erstaunlich: Nach nur einer Woche hatte sich die Lebenszufriedenheit der TeilnehmerInnen, die auf Facebook verzichtet hatten, signifikant gesteigert. Auch ihre Stimmung war deutlich gehobener als die der Facebook-NutzerInnen: verglichen mit diesen fühlten sie sich glücklicher, sowie weniger traurig und einsam. Auch erfuhren sie einen Anstieg ihrer sozialen Aktivitäten und waren nach der Woche ohne Facebook zufriedener mit ihrem Sozialleben als zuvor. Sie konnten sich besser konzentrieren, fühlten sich weniger gestresst und gaben an, deutlich weniger das Gefühl zu haben, ihre Zeit zu verschwenden, als noch vor der Facebook-freien Woche.
Der Einfluss sozialer Medien auf die Lebenszufriedenheit
Wie kann eine nur einwöchige Abstinenz von sozialen Medien einen so deutlichen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit haben? Die Forschergruppe des Happiness Research Institute vermuten, dass es vor allem der soziale Vergleich ist, der dazu führt, dass sich Menschen, die regelmäßig soziale Medien nutzen, unglücklicher fühlen. Soziale Medien sind keine Spiegel der Realität: Menschen stellen ihre guten Seiten in den Vordergrund und posten Fotos von großartigen Erlebnissen – das aber macht soziale Medien zu einem „Non-Stop-Good-News-Channel“, einem kontinuierlichen Informationsfluss über aufpolierte Leben, der die Wahrnehmung der Realität vollkommen verzerrt.
Weitere Befragungsergebnisse scheinen diese Vermutung zu unterstützen, denn fünf von zehn Facebook-Nutzern geben an, andere um die großartigen Erlebnisse, die diese posten, zu beneiden. Einer von drei Facebook-Nutzern beneidet andere darum, wie glücklich sie auf deren Facebook-Seiten erscheinen. Und vier von zehn Facebook-Nutzern beneiden andere um deren scheinbaren Erfolg. – Ein Vergleichen auf sozialen Medien macht jedoch unglücklich: Regelmäßige Facebook-Nutzer weisen eine 39%-ige Wahrscheinlichkeit auf, weniger glücklich zu sein als ihre Freunde.
Nun sind soziale Medien aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Allerdings ist es wichtig, dabei nicht zu vergessen, dass die dort dargestellte „Realität“ eine stark verzerrte ist. Ein Vergleich mit den so erfolgreich und glücklich erscheinenden Menschen ist nun einmal unrealistisch und macht noch dazu unglücklich. Um sich also von sozialen Medien nicht die Lebensqualität rauben zu lassen, ist es sinnvoller, sich darauf zu konzentrieren, was man selbst wirklich braucht – und nicht darauf, was andere scheinbar haben.
Quellen:
The Facebook Experiment, The Happiness Research Institute, 2015
abrufbar unter: Happiness Research Institute
Emotionale Intelligenz: Die Fähigkeit Emotionen zu erkennen beeinflusst das Jahresgehalt
Emotionale Intelligenz, die Fähigkeit, eigene und fremde Emotionen erkennen und sie unterscheiden zu können, ist in den letzten Jahren in den Fokus der psychologischen Forschung gerückt. Es geht darum diese Informationen zu nutzen, um das eigene Denken und Handeln zu lenken. Emotionale Intelligenz gilt als wichtige Schlüsselkompetenz, um im Privatleben, in der Schule und im Beruf erfolgreich sein zu können. Eine neue Studie ermittelte nun sogar einen Zusammenhang mit dem Jahresgehalt.
Wer emotional intelligent ist und so Gefühle, Stimmungen, Leidenschaften und ähnliche emotionale Zustände an sich selbst und anderen richtig erkennt, kann diese Informationen nutzen und damit erfolgreicher im Privat- und Berufsleben sein. Die Ergebnisse einer Studie von Jochen Menges, Professor an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf, gehen noch darüber hinaus: Die Forscher stellten fest, dass sich die Emotionserkennungsfähigkeit auf das Einkommen auswirkt.
Emotionale Intelligenz
John D. Mayer von der University of New Hampshire und Peter Salovey von der Yale University, Begründer der Forschung zu Emotionaler Intelligenz, beschreiben diese als die Fähigkeit, Emotionen an sich selbst und anderen korrekt erkennen und unterscheiden zu können und dies als Informationen nutzen zu können, die das eigene Denken und Handeln lenken. Intelligenz geht also, ihrer Ansicht nach, weit über den klassisch akademischen Intelligenzbegriff hinaus und umfasst nicht nur verbale und numerische Fähigkeiten. Um beruflich und privat erfolgreich sein zu können, reicht es also nicht, in der Schule gute Aufsätze zu schreiben und mathematische Zusammenhänge zu erkennen. Vielmehr seien es Fähigkeiten, die helfen Emotionen zu erkennen und zu beeinflussen, die zu Lebenserfolg nachhaltig beitragen.
Emotionale Intelligenz umfasst somit die Fähigkeit, eigene Emotionen richtig zu erkennen und sie so zu handhaben, dass sie der Situation angemessen sind und helfen, die eigenen Ziele zu erreichen. Empathie, also die Fähigkeit, Emotionen an anderen zu erkennen und mit diesen angemessen umgehen zu können, wird ebenfalls der Emotionalen Intelligenz zugezählt.
Emotionserkennung als ökonomischer Erfolgsfaktor
Mit ihrer Studie konnten Forscher nun die These von Mayer und Salovey bestätigen, denn Emotionserkennung, ein Teilaspekt der Emotionalen Intelligenz, erhöht nicht nur den allgemeinen Lebenserfolg, sondern auch den finanziellen: Sie fanden einen direkten Zusammenhang zwischen der Emotionserkennungsfähigkeit und der Höhe des Jahresgehalts. Mitarbeiter, die Gefühle von anderen besser erkennen konnten, hatten verdienten deutlich besser als ihre Kollegen, die diese Fähigkeit nicht oder nur in geringem Maße aufwiesen. Andere Faktoren wie akademische Intelligenz, Gewissenhaftigkeit, Geschlecht, Alter, Ausbildung, Wochenarbeitszeit und hierarchische Position im Unternehmen wurden in die Untersuchung miteinbezogen, doch auch unter Berücksichtigung dieser Variablen blieb der Zusammenhang zwischen Emotionserkennungsfähigkeit und Jahresgehalt bestehen. Diese Fähigkeit ist also nicht nur von zwischenmenschlicher Bedeutung, sondern hat auch einen deutlichen ökonomischen Wert.
Euphorie – mit Vorsicht
Sicherlich sind diese Ergebnisse erstaunlich und machen deutlich, wie wichtig Emotionale Intelligenz für Lebenserfolg ist. Menschen mit guter Emotionserkennung verhalten sich geschickter in sozialen Kontexten und werden als kooperativer, rücksichtsvoller und hilfreicher eingeschätzt.
Dennoch beinhaltet diese Form der Intelligenz auch die Fähigkeit zur Beeinflussung der Gefühle anderer. Dies kann zum Positiven geschehen, aber auch bedeuten, dass gezielt positive Emotionen geweckt werden, damit Mitarbeiter immer mehr leisten oder Kunden immer bereitwilliger kaufen. Diese Form der manipulativen Beeinflussung, die lediglich einseitig dem Erreichen der Unternehmensziele dient, ist sicher nicht im Sinne der Begründer der Forschung zu Emotionaler Intelligenz.
Emotionale Intelligenz geht weit über die akademische Bildung hinaus. Sie hilft, in sozialen Kontexten erfolgreich zu sein und trägt damit deutlich zum allgemeinen Lebenserfolg bei. Es ist abzusehen, dass ihr dank ihrer Funktion als Wirtschaftsfaktor in Zukunft in der Personalführung und auch in Bildungseinrichtungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden wird.
Quellen:
Goleman, D. (1996). Emotional Intelligence. Why It Can Matter More than IQ. Learning, 24(6), 49-50.
Menges, J., & Ebersbach, L. (2008). Die Bedeutung von Emotionen und emotionalem Kapital im internen und externen Unternehmenskontext. Eine Mentalitätsgeschichte der deutschen Industriegesellschaft am Beispiel des rheinischen Dormagen (1917-1997), Essen, 21-44.
Momm, T., Blickle, G., Liu, Y., Wihler, A., Kholin, M., & Menges, J. I. (2015). It pays to have an eye for emotions: Emotion recognition ability indirectly predicts annual income. Journal of Organizational Behavior, 36(1), 147-163.
60 Millionen im Jackpot: Warum ein Gewinn nicht immer glücklich macht
60 Millionen Euro gibt es am Freitag beim Eurojackpot zu gewinnen. Warum ein Lottogewinn nicht immer glücklich macht, erzählt ein Glücksforscher, der an der Uni Augsburg doziert. Von Niklas Molter
Zum Interview mit Dr. Stephan Lermer in der Augsburger Allgemeinen gelangen Sie hier
Wie im Coaching und Training der Placebo-Effekt die Leistungsfähigkeit steigern kann.
Es gehört zum speziellen Coaching-Stil von Dr.Lermer, dass er seinem Klienten begegnet, als wäre er bereits einen Schritt weiter in Richtung seiner Idealversion. Diese Dynamik, die sich daraus ergibt, ist mit selbsterfüllender Prophezeihung verwandt, so dass man das erfahrene Zutrauen auch erfüllt, den erhaltenen Vertrauensvorschuß nicht verspielen möchte. Ähnlich, wie wenn einem sein Mentor im Bereich Sport oder Kunst, ja überall bei relevanten Leistungen zuflüstert: Trau Dich, das schaffst Du schon! Auf diesem Gebiet wurde nun eine Studie veröffentlicht, deren Ergebnisse nicht überraschen, sondern eher wichtig sind dank ihrer wissenschaftlichen Absicherung.
Zwei Psychologen, Prof.Ulrich Weger von der Universität Witten/Herdecke und Dr. Stephen Loughnan von der Universität Melbourne schafften Klarheit: Sie gingen der Frage empirisch nach, ob jemand tatsächlich bessere Ergebnisse zeitigt, wenn er von seiner Leistungsfähigkeit überzeugt ist. Dafür wurde eine Gruppe von 40 Versuchspersonen halbiert, wobei die eine Hälfte unvorbereitet blieb. Der andere Teilgruppe wurde gezielt Selbstvertrauen suggeriert, womit sie ihrer Intuitiuon und ihrem eigenen Wissen vertrauen könnten.
Im folgenden Wissenstest lieferten die „aufgebauten“ Teilnehmer durchschnittlich 9,9 Aufgaben, die andere Hälfte kam auf durchschnittlich 8,4 richtige Lösungen. Das Wissen selbst war ja nicht trainiert worden, lediglich die mentale Haltung zu den eigenen Fähigkeiten. Hier scheint die Vorbereitung tatsächlich implizit lähmende Ängste ersetzt zu haben durch Zuversicht, die man von den Betreuern in Form von Unterstützung erfahren hatte. Prof.Weger meinte dazu wörtlich: „WIr haben ja nicht das Wissen verbessert. Aber das Gefühl von Unterstützung und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wurden gestärkt. Wir vermuten, dass sich diese Personen dannz.B. mehr angestrengt haben, besser ihre eigenen Ängste überwinden konnten, systematischer überlegt haben. Sie konnten schlichtweg das vorhandene Wissen besser abrufen und dadurch hat sich die Leistung dann tatsächlich verbessert.“
Quelle: Weger, Ulrich W., Loughnan, Stephen (2013) „Mobilizing unusual resources: Using the placebo concept to enhance cognitive performance“. The Quart.J.of Exp.Psychol. 2013, 66, 23-28
Coaching: Psychohygiene rechnet sich – denn trübsinnige Stimmung führt zu kurzsichtigen Entscheidungen
Die klassische Coaching-Empfehlung von Dr.Lermer, wichtige Entscheidungen nicht im Stimmungstief, sondern im Plus-Zustand zu treffen, wurde wieder einmal wissenschaftlich bestätigt. Die Harvard-Professorin Jenniver Lerner und ihr Team konnten belegen, wie eine traurige Stimmunslage direkt zu negativ irrationalen Entscheidungen führt. In ihrem Experiment stellte sie 600 Versuchspersonen die klassiche Frage, ob sie lieber einen kleineren Geldbetrag von 25 Dollar sofort oder 85 Dollar wählen würden, wobei es den größeren Geldbetrag nicht sofort, sondern erst in ein paar Wochen gibt. Dann wurden den Subgruppen a) ein trauriger Film b) ein ekliger und c) gar kein Film dargeboten. Signifikant unterschiedlich zu den anderen Gruppen entschieden sich die Betrachter a) des traurigen Films für das schnelle kleine Geld, und damit für die schlechtere Variante.
Fazit: Traurigkeit schlägt Hoffung und Vertrauen und (ver-)führt zu kursichtigen Entscheidungen. Lerner nenn das Phänomen myopic misery. Unsere Empfehlung daraus: In Situationen trauriger Stimmung entweder die Ursachen dafür auflösen, sich ablenken oder abwarten („wait and see“). Und Entscheidungen erst wieder dann treffen, wenn man hoffnungsgeladen und voller Vertrauen aufs Gelingen wieder souverän und damit in der Lage ist erfolgreiche Entscheidungen zu treffen.
Quelle: Lerner, Jenniver S., Weber, Elke U., The Financial Costs of Sadness. Psychological Science 2012, 13
Schöner Schein…
Das englische Sprichwort „don’t judge a book by its cover“ (“Bewerte ein Buch nicht nach seinem Einband”) mahnt auf metaphorische Wiese davor, den Wert oder das Innere einer Sache oder Person anhand seines Aussehens zu beurteilen. Dennoch lassen wir uns täglich von der Schönheit verführen und blenden …
Die „what is beautiful – is good“-Theorie beschreibt dieses Phänomen: attraktiven Menschen werden Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschrieben, die mit dem Äußeren nichts zu tun haben. Wir schließen permanent von der äußeren, auf die innere Schönheit.
So wie wir Menschen anhand anderer Eigenschaften und Merkmale schnell einen Stempel aufdrücken, der mit diesem Merkmal nichts zu tun haben muss (z.B. „Dicke sind gemütliche Gesellen“, „Brillenträger sind klug“, „Männer im Anzug sind erfolgreich“), fungiert auch hier der sogenannte „Attraktivitätsstereotyp“ (Henss, 1992) als Wahrnehmungsfilter, um die überaus komplexe Welt um uns herum für sich selbst zu ordnen. Dadurch wird ein Kontrollgefühl evoziert und sogar Handlungsfähigkeit geschaffen. Denn wenn man sein Gegenüber erst einmal „etikettiert“ hat, also einschätzen kann, mit wem man es wohl zu tun hat, dann man kann angemessener reagieren. Alles und jeden aber derart differenziert und in seiner Vielschichtigkeit erfassen zu wollen, würde allerdings unser Wahrnehmungssystem lahm legen. Die Folge: wir würden zu gar nichts mehr kommen. Deshalb ist die Stereotypisierung für den Menschen durchaus funktional, wenn auch nicht immer korrekt und vor allem auch nicht immer fair (Segal-Caspi, Roccas, & Sagiv, 2012).
Schon 1972 konnten die Psychologen Dion, Walster und Berscheid (1972) zeigen, dass attraktive Kinder in der Schule weniger oft bestraft werden, attraktive Studenten bessere Noten bekommen, ja selbst die Berufschancen stehen für attraktive Menschen besser. In Ihrer Übersichtsarbeit zeigte Judith Langlois und ihr Forscherteam (2000), dass sowohl attraktive Kinder als auch Erwachsene generell für sozial kompetenter gehalten werden, egal ob in der Schule oder im Berufsleben.
Verblüffender weise schafft diese heuristische Zuschreibung oftmals eine eigene Realität – wirkt somit als selbsterfüllende Prophezeiung: Schönen Menschen werden sozial erwünschte Charakterzüge (Aufgeschlossenheit, Freundlichkeit, Geselligkeit) zugeschrieben, weshalb man diesen Menschen entsprechend offen, freundlich und wohlwollend gegenübertritt. Wie es in den Wald reinschallt, so schallt es heraus. Als Folge davon reagieren die „Schönen“ tatsächlich so, wie es dem „Attraktivitätsstereotyp“ nach erwartet wird.
Dies konnte Snyder, Berscheid und Tanke (1977) in ihrem klassischen psychologischen Experiment aufgezeigen: Sie ließen 51 männliche und 51 weibliche Studenten/Innen ein zehnminütiges Telefonat führen. Das Gesprächspaar war sich jeweils unbekannt. Die männlichen Probanden erhielten einen kurzen Fragebogen der Telefonpartnerin, sowie ein Foto, welches angeblich die Dame am anderen Ende der Leitung zeigen sollte. Tatsächlich waren es anderen Frauen, die zuvor nach Attraktivität beurteilt worden waren. Die Hälfte der männlichen Studienteilnehmer bekam Fotos von sehr attraktiven, die andere Hälfte von sehr unattraktiven Frauen.
Vor dem Telefonat gaben die Männer ihre Erwartung bzgl. Intelligenz, physische Attraktivität und Freundlichkeit der Telefonpartnerin an. Ganz der „what is beautiful – is good“-Theorie folgend, erwarteten die Männer, denen ein attraktives Foto zugespielt wurde, eine kontaktfreudige, humorvolle und aufgeschlossene Frau am Hörer. Dementsprechend negativ war die Erwartung bei den Männern mit den unattraktiven Fotos.
Auch die Gesprächsfrequenz wurde von den Psychologen ausgewertet. Das Ergebnis bestätigte die Annahme der „selbsterfüllenden Prophezeiung“: Frauen, die vom männlichen Telefonpartner für attraktiv gehalten wurden, wirkten selbstbewusster, schienen das Gespräch mehr zu genießen und den Gesprächspartner zu mögen. Genau das gegenteilige Bild zeigte sich bei den Frauen, die für unattraktiv gehalten wurden. Darüber hinaus wirkten auch die Männer, die annahmen, mit der attraktiven Frau zu telefonieren, auf die bewertenden Psychologen attraktiver und selbstbewusster.
Segal-Caspi, Roccas, & Sagiv (2012) von der israelischen Open Universität gingen in einem weiterem Experiment zu diesem Phänomen der Frage nach, ob die „Schönen“ tatsächlich jene Eigenschaften und Werte zeigten, die ihnen zugschrieben wurden.
118 weibliche Probanden wurden dabei gefilmt, wie sie den Wetterbericht vorlasen und danach den Raum verließen. Dieses Video wurde von Männern und Frauen hinsichtlich Attraktivität (Gesicht, Körper, Kleidung), innerer Werte und Eigenschaften bewertet. Auch in dieser Studie wurden die körperlich attraktiven Frauen als liebenswürdiger, offenherziger, extravertierter, gewissenhafter und emotional stabiler bewertet.
Interessanterweise gab es gar keinen Zusammenhang dieser attraktivitätsbasierten Einschätzung mit den Selbstangaben der Frauen über ihre Eigenschaften und Wertvorstellungen. Der schöne Schein trügt eben manchmal…
Quellen:
Dion, K., Berscheid, E. & Walster, E. (1972). What is beautiful is good. Journal of Personality and Social Psychology, 24, 285-90.
Henss, R. (1992). „Spieglein, Spieglein an der Wand . . .“ Geschlecht, Alter und physische Attraktivita [„Mirror, mirror on the wall …“ Sex, age, and physical attractiveness]. Weinheim, Germany: Psychologie Verlags Union.
Snyder, M., Tanke, E. & Bersheid, E. (1977). Social perception and interpersonal behavior: On the self-fulfilling nature of social stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 656-666.
Judith Langlois et. al (2000). Maxims or Myths of Beauty? A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin, 126, 390-423.
Segal-Caspi, L, Roccas, S. & Sagiv, L. (2012). Don’t Judge a Book by Its Cover, Revisited: Perceived and Reported Traits and Values of Attractive Women. Psychological Science, 23, 1112-1116.