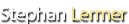Leidet die Liebe, weil sie ihn überholt?
„Wenn die Frau erfolgreicher ist und deutlich mehr verdient, kann es sein, dass der Mann Probleme hat. Konkurrenz innerhalb einer Partnerschaft ist Gift. Man ist schließlich ein Team“, erklärt der Münchner Psychologe Dr. Stephan Lermer. Zum ganzen Beitrag geht es unter: Bunte.de
Blondes Gift oder Engel ?
Blondinen gelten einerseits als naiv und einfältig, andererseits als Wesen mit sonnigem Gemüt, die mehr Spaß als alle anderen haben. In Filmen oder Literatur verkörpern sie häufig das raffinierte Biest, das Männer mit einem verführerischen Augenaufschlag um den Finger wickelt: Um keine andere Haarfarbe ranken sich so viele Mythen. Was ist eigentlich dran an den Vorurteilen, mit denen hellhaarige Frauen immer wieder konfrontiert werden und sie oft ungerechterweise zur Zielscheibe unzähliger Witze machen?
Häufig steckt sicher eine gute Portion Neid dahinter. Eine Blondine zieht fast überall die Aufmerksamkeit anderer auf sich. Die goldene Haarpracht ist nun mal auffälliger als ein dunkler Schopf. Nicht umsonst heißt ein Film mit Marilyn Monroe „Blondinen bevorzugt“. Denn laut Psychologe Stephan Lermer haben Blondinen es bei der Partnersuche tatsächlich etwas leichter als ihre dunkel- und rothaarigen Geschlechtsgenossinnen. „60 Prozent der deutschen Männer wünschen sich eine blonde Frau.“ Dass nur acht Prozent der deutschen Frauen von Geburt an blond sind, wie Lermer weiß, macht echte Blondinen zu einer attraktiven Rarität. „Das ist etwas Seltenes und wertvoll – wie Diamanten und Gold. Wenn die Blondine feststellt, dass sie so hoch gehandelt wird, kann es sein, dass sie ihre Attraktivität möglicherweise nutzt, um Männer zu verführen.“
Helles Haar macht jünger
Gleichzeitig wirke Blond jugendlich, sagt der Psychologe in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Denn graue Strähnen fallen bei Blonden weniger auf als bei Brünetten. Wer gern aus der Menge herausstechen will, aber nicht von Natur aus mit einem hellen Schopf gesegnet ist, lässt sich daher gern von einem Friseur in eine Blondine verwandeln. Männer könnten oftmals den Unterschied zwischen echt und unecht nicht unterscheiden, es sei denn, es handele sich um ein Platinblond, betont Lermer. Vor allzu starker Aufhellung warnt er jedoch. Die auffällige, wasserstoffblonde Frau wirke, wenn sie dementsprechend noch auffällig geschminkt sei, oft billig. „Sie bedient jede Menge Männerfantasien und sie wirkt, als sei sie leicht zu haben.“ Dadurch zögen Blondinen häufig den Neid von dunkelhaarigen Frauen auf sich, die umschwärmte Hellhaarige gern als „Blondes Gift“ bezeichnen. Seine Geschlechtsgenossen nimmt Lermer augenzwinkernd in Schutz. „Die Männer kapieren gar nicht, was da läuft. Sie sind Opfer und reagieren nur darauf.“
Rein wie eine Märchenfigur
Dass blonde Damen trotzdem mit Attributen wie Sanftmut, Reinheit und Unschuld assoziiert werden, liegt unter anderem daran, dass die meisten Märchenfiguren helle Haare haben. „Auch Feen, Engel, Loreley, das Gretchen aus Faust und Barbie sind alle blond“, berichtet der Münchner Therapeut. Blonde gelten dadurch als harmlos. Außerdem kann man bei ihnen Gefühlsregungen leichter erkennen. „Ein Mensch, der positive Emotionen ausstrahlt, hat geweitete Pupillen“, sagt Lermer. Da die meisten echten Blondinen eine helle Iris haben, wirke sie im Gegensatz zu Dunkeläugigen unbewusst kalkulierbarer.
Natürlich lässt sich die Intelligenz eines Menschen nicht an der Haarfarbe festmachen. Warum Blondinen im Allgemeinen aber häufig trotzdem als Dummchen dargestellt werden, liege gemäß Lermer auch daran, dass sie Opfer einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Sagen die Eltern ihrem Kind häufig: „Du bist unser blondes Hübschchen, du sieht aus wie Barbie“, könnte es sein, dass das Kind sich diese Eigenschaften tatsächlich aneignet und sich weniger anstrengt. Das Kind sagt sich: „Ich bin blond und schön, das ist halt so“, erzählt Lermer. „Blonde Mädchen haben weniger Druck und Motivation, einen höheren Bildungsstand zu erreichen.“ Dazu passt ein Klischee, das häufig bei TV-Serien bedient wird. „Die Dunkelhaarige ist die Ärztin und die Blonde Krankenschwester.“
Unterhaltungsformate im Fernsehen, die vor allem It-Girls mit blonder Mähne in den Fokus rücken, sorgen ebenfalls dafür, dass sich das Bild der einfältigen Blondine hartnäckig hält. Die inzwischen erblondete Brünette Verona Pooth habe etwa den Weg für Blondinen geebnet, die mit dem Klischee spielen, sagt Lermer. Davon profitieren beispielsweise die amtierende Dschungelkönigin Melanie Müller oder ehemalige „Germany’s next Topmodel“-Kandidatinnen wie Sarah Knappik und Gina-Lisa Lohfink.
Ambivalente Berufschancen
Wie die beruflichen Chancen bei hellem Kopfschmuck generell aussehen, sei ambivalent. „Wenn ein Personaler Vorurteile hat, traut er einer Blondine weniger zu“, sagt Lermer. Es könne aber auch sein, dass man die Blondine eher einstellt, um sich mit ihr zu schmücken, betont der Psychologe. Wolle eine blonde Frau Karriere machen will, müsse sie sich häufig mehr anstrengen. „Weil man ihr erst nicht zutraut, dass sie das stemmen kann.“ Sich die Haare dunkel zu färben, um einen Job zu bekommen, sei dagegen Quatsch. „Gerade Authentizität ist eine Kraftquelle. Wenn man authentisch ist, ist man überzeugungsstärker.“
In der Medienwelt sei es oft so, dass sehr viele Moderatorinnen blond seien, so der Therapeut und zählt auf: „Sabine Christiansen, Frauke Ludowig, Barbara Schöneberger oder Linda de Mol. „Das ändert sich aber gerade, indem die Dunkelhaarigen nachziehen.“
Was bei Frauen auf der Tagesordnung steht, gilt aber noch lange nicht für die Herren der Schöpfung. Hellhaarige Männer dagegen bleiben laut Lermer von den Vorurteilen zwar vorschont. Gleichzeitig sind sie aber nicht so begehrt wie ihre weiblichen Gegenstücke. „Die meisten Frauen träumen von einem Dunkelhaarigen, Typ promovierter Holzfäller“, sagt der Psychologe. „Der was im Kopf und Muckis hat, und es im Bett bringt.“
12. April 2014
Adresse des Artikels:
http://www.morgenweb.de/2.254/freizeit/lifestyle/blondes-gift-oder-engel-1.1652067
„Ein sinnliches Gesamtkunstwerk“ – Der Münchner Glücksforscher Dr. Stephan Lermer erklärt in der MAZ exklusiv, warum Oktoberfeste so beliebt sind
Als Wahnsinns-Gaudi und Mega-Event mit über sechs Millionen Besuchern strahlt das Münchner Oktoberfest weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus. Mit Brezn, Haxn und einer frischen Maß Bier wird die Wiesn assoziiert – und so kommt es, dass immer im Herbst viele Menschen in der ganzen Bundesrepublik, teilweise sogar im Ausland Oktoberfest feiern.
Doch woher kommt die Faszination dieses über 200 Jahre alten Fests, das erstmals im Jahr 1810 anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese in München gefeiert wurde?
Im MAZ-Gespräch geht der Münchner Glücksforscher und Psychologe Dr. Stephan Lermer
dieser Frage nach.
Herr Dr. Lermer, wie erklären Sie sich die Faszination, die vom Oktoberfest ausgeht?
Lermer: „Ich denke, bei diesem Riesen-Spektakel werden schlichtweg archaische Bedürfnisse im Menschen geweckt. Dort steigt der Rauch auf, dort spielt die Musik. Jeder will dabei sein. Es ist ein Sehen und gesehen werden. Hinzu kommen laute Musik und Fahrgeschäfte mit einem gewissen Nervenkitzel. Außerdem möchte man mit einem Besuch zeigen, dass man es sich leisten kann.“
Es ist aber auch so, dass in der ganzen Republik, ja inzwischen quasi schon weltweit Oktoberfeste gefeiert werden. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
Lermer: „Das ist eine Inflationierung. Der Grund ist: Man will sich eine Scheibe dieses Events abschneiden. Aber solche Feste Feste sind wichtig, um aus dem Alltag auszubrechen. In der heutigen modernen Zeit sind viele Rituale verlorengegangen, da versuchen die Menschen, Ersatz zu schaffen.“ Hört man Oktoberfest, denkt man sogleich die Brezn und die Maß Bier.
Welche Rolle spielt die Symbolik bei der Faszination dieses Festes?
Lermer: „Alle Sinne werden bedient. Intensive Gerüche von gebratenen Mandeln oder der Wurtsbraterei. Man sieht tiefe Dekolletés, knackige Waden der Männer. Man sieht hübsche Kleidung und gönnt sich zur Brezn ein frisches Bier. Hinzu kommt ein hoher erotischer Flirtfaktor. Man sitzt eng zusammen, kommt sich rasch nahe, lacht und singt zusammen. Das Ganze ist ein sinnliches archaisches Gesamtkunstwerk.“
Das Ganze hat aber auch einen gewissen Faschings-Charakter…
Lermer: „Richtig, das ist mit Karneval oder Fasching vergleichbar. Wir schlüpfen ja auch hier in Rollen und brechen aus dem Alltag aus.“
Indem wir in das Dirndl oder die Lederhose schlüpfen?
Lermer: „Wir spielen á la Shakespeare das ganze Leben lang Rollen. Und beim Oktoberfest zeigen wir, dass wir offen sind für das Sinnliche. Hinzu kommt: Das Dirndl steht eigentlich jeder Frau. Es macht jede Frau hübscher. Der Mann wiederum zeigt in der Lederhosen-Tracht seine Muskeln und seine Waden. Da weden klassische Rollenbilder bedient.“
Aus Sicht des Glücksforschers begrüßen Sie also das Ritual, solche Festivitäten zu feiern?
Lermer: „Ja, man sollte aber seine Grenzen kennen und an morgen denken. Das ist wie bei der Weihnachtsfeier in der Firma. Genuss ja, aber alles in Maßen.“
[Anmerkung: Der Artikel ist auch als PDF erhältlich unter diesem link: Lermer_Oktoberfest]
Schöner Schein…
Das englische Sprichwort „don’t judge a book by its cover“ (“Bewerte ein Buch nicht nach seinem Einband”) mahnt auf metaphorische Wiese davor, den Wert oder das Innere einer Sache oder Person anhand seines Aussehens zu beurteilen. Dennoch lassen wir uns täglich von der Schönheit verführen und blenden …
Die „what is beautiful – is good“-Theorie beschreibt dieses Phänomen: attraktiven Menschen werden Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschrieben, die mit dem Äußeren nichts zu tun haben. Wir schließen permanent von der äußeren, auf die innere Schönheit.
So wie wir Menschen anhand anderer Eigenschaften und Merkmale schnell einen Stempel aufdrücken, der mit diesem Merkmal nichts zu tun haben muss (z.B. „Dicke sind gemütliche Gesellen“, „Brillenträger sind klug“, „Männer im Anzug sind erfolgreich“), fungiert auch hier der sogenannte „Attraktivitätsstereotyp“ (Henss, 1992) als Wahrnehmungsfilter, um die überaus komplexe Welt um uns herum für sich selbst zu ordnen. Dadurch wird ein Kontrollgefühl evoziert und sogar Handlungsfähigkeit geschaffen. Denn wenn man sein Gegenüber erst einmal „etikettiert“ hat, also einschätzen kann, mit wem man es wohl zu tun hat, dann man kann angemessener reagieren. Alles und jeden aber derart differenziert und in seiner Vielschichtigkeit erfassen zu wollen, würde allerdings unser Wahrnehmungssystem lahm legen. Die Folge: wir würden zu gar nichts mehr kommen. Deshalb ist die Stereotypisierung für den Menschen durchaus funktional, wenn auch nicht immer korrekt und vor allem auch nicht immer fair (Segal-Caspi, Roccas, & Sagiv, 2012).
Schon 1972 konnten die Psychologen Dion, Walster und Berscheid (1972) zeigen, dass attraktive Kinder in der Schule weniger oft bestraft werden, attraktive Studenten bessere Noten bekommen, ja selbst die Berufschancen stehen für attraktive Menschen besser. In Ihrer Übersichtsarbeit zeigte Judith Langlois und ihr Forscherteam (2000), dass sowohl attraktive Kinder als auch Erwachsene generell für sozial kompetenter gehalten werden, egal ob in der Schule oder im Berufsleben.
Verblüffender weise schafft diese heuristische Zuschreibung oftmals eine eigene Realität – wirkt somit als selbsterfüllende Prophezeiung: Schönen Menschen werden sozial erwünschte Charakterzüge (Aufgeschlossenheit, Freundlichkeit, Geselligkeit) zugeschrieben, weshalb man diesen Menschen entsprechend offen, freundlich und wohlwollend gegenübertritt. Wie es in den Wald reinschallt, so schallt es heraus. Als Folge davon reagieren die „Schönen“ tatsächlich so, wie es dem „Attraktivitätsstereotyp“ nach erwartet wird.
Dies konnte Snyder, Berscheid und Tanke (1977) in ihrem klassischen psychologischen Experiment aufgezeigen: Sie ließen 51 männliche und 51 weibliche Studenten/Innen ein zehnminütiges Telefonat führen. Das Gesprächspaar war sich jeweils unbekannt. Die männlichen Probanden erhielten einen kurzen Fragebogen der Telefonpartnerin, sowie ein Foto, welches angeblich die Dame am anderen Ende der Leitung zeigen sollte. Tatsächlich waren es anderen Frauen, die zuvor nach Attraktivität beurteilt worden waren. Die Hälfte der männlichen Studienteilnehmer bekam Fotos von sehr attraktiven, die andere Hälfte von sehr unattraktiven Frauen.
Vor dem Telefonat gaben die Männer ihre Erwartung bzgl. Intelligenz, physische Attraktivität und Freundlichkeit der Telefonpartnerin an. Ganz der „what is beautiful – is good“-Theorie folgend, erwarteten die Männer, denen ein attraktives Foto zugespielt wurde, eine kontaktfreudige, humorvolle und aufgeschlossene Frau am Hörer. Dementsprechend negativ war die Erwartung bei den Männern mit den unattraktiven Fotos.
Auch die Gesprächsfrequenz wurde von den Psychologen ausgewertet. Das Ergebnis bestätigte die Annahme der „selbsterfüllenden Prophezeiung“: Frauen, die vom männlichen Telefonpartner für attraktiv gehalten wurden, wirkten selbstbewusster, schienen das Gespräch mehr zu genießen und den Gesprächspartner zu mögen. Genau das gegenteilige Bild zeigte sich bei den Frauen, die für unattraktiv gehalten wurden. Darüber hinaus wirkten auch die Männer, die annahmen, mit der attraktiven Frau zu telefonieren, auf die bewertenden Psychologen attraktiver und selbstbewusster.
Segal-Caspi, Roccas, & Sagiv (2012) von der israelischen Open Universität gingen in einem weiterem Experiment zu diesem Phänomen der Frage nach, ob die „Schönen“ tatsächlich jene Eigenschaften und Werte zeigten, die ihnen zugschrieben wurden.
118 weibliche Probanden wurden dabei gefilmt, wie sie den Wetterbericht vorlasen und danach den Raum verließen. Dieses Video wurde von Männern und Frauen hinsichtlich Attraktivität (Gesicht, Körper, Kleidung), innerer Werte und Eigenschaften bewertet. Auch in dieser Studie wurden die körperlich attraktiven Frauen als liebenswürdiger, offenherziger, extravertierter, gewissenhafter und emotional stabiler bewertet.
Interessanterweise gab es gar keinen Zusammenhang dieser attraktivitätsbasierten Einschätzung mit den Selbstangaben der Frauen über ihre Eigenschaften und Wertvorstellungen. Der schöne Schein trügt eben manchmal…
Quellen:
Dion, K., Berscheid, E. & Walster, E. (1972). What is beautiful is good. Journal of Personality and Social Psychology, 24, 285-90.
Henss, R. (1992). „Spieglein, Spieglein an der Wand . . .“ Geschlecht, Alter und physische Attraktivita [„Mirror, mirror on the wall …“ Sex, age, and physical attractiveness]. Weinheim, Germany: Psychologie Verlags Union.
Snyder, M., Tanke, E. & Bersheid, E. (1977). Social perception and interpersonal behavior: On the self-fulfilling nature of social stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 656-666.
Judith Langlois et. al (2000). Maxims or Myths of Beauty? A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin, 126, 390-423.
Segal-Caspi, L, Roccas, S. & Sagiv, L. (2012). Don’t Judge a Book by Its Cover, Revisited: Perceived and Reported Traits and Values of Attractive Women. Psychological Science, 23, 1112-1116.
Warum Frauen (wirklich) schlechter einparken
Weil es die Forscher der Universität Bochum nicht ganz glauben konnten, prüften sie es jetzt selbst noch einmal. Nur um herauszufinden: Frauen parken wirklich schlechter ein als Männer.
Sie steckten 65 Autofahrer (darunter 17 Fahranfänger) beider Geschlechter in einen Audi A6 und ließen sie in enge Parklücken rangieren. Männer waren dabei im Schnitt 42 Sekunden (!) schneller. Und genauer.
Doch die Forscher wären keine, wenn sie nicht auch die Gründe für den Unterschied untersucht hätten. Das Ergebnis: tatsächlich war das räumliche Vorstellungsvermögen der männlichen Versuchsteilnehmer besser ausgeprägt. Ein deutlicher Vorteil fürs Einparken. Doch die Forscher fanden auch eine psychologische Komponente.
Männer bewerten ihre Einpark-Fähigkeiten schon vorab als deutlich höher. Und sie hatten im Schnitt generell ein höheres Selbstwertgefühl. Sie sahen die Parklücke als Herausforderung, hatten deshalb weniger Bedenken und waren wesentlich zügiger. Frauen sahen die Parklücke als Gefahr, die sie vermeiden wollten. Dem entsprechend hatten Sie Zweifel, die sie zu einem gewissen Grad „lähmten“.
Der pragmatische Tipp der Forscher: Die „Bedrohung“ Parklücke sollte als Herausforderung gesehen werden. Dann klappt’s auch mit dem Einparken.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: ddp