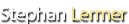Psychologische Begriffe: „Intrinsische Motivation“
Wenn ich mich abends ans Klavier setze, um etwas zu komponieren kann es sein, dass ich die Zeit vergesse. Obwohl man das Komponieren als Arbeit bezeichnen könnte, deren Ergebnisse dazu dienen anderen Leuten Spaß zu machen, fühlt es sich so an, als würde allein das Spielen, Improvisieren, Aufnehmen und Aufschreiben der Noten den Lohn der Arbeit darstellen. Ich fühle mich gut.
Wenn ich morgens routinemäßig die Emails checke und beginne, sie zu beantworten, kann es sein, dass ich einen gewissen Widerwillen gegen diese Aufgabe spüre. Ich muss mich dann zwingen, die immer gleichen Formulierungen zu bemühen oder ad hoc Lösungen für brennende Probleme zu suchen oder Termine abzustimmen. Obwohl ich anerkenne, dass die Tätigkeit für mich und für andere wichtig ist, muss ich mir die Ergebnisse und positiven Folgen meiner Schreiberei vor Augen führen, damit ich wirklich „dran bleibe“. Wo es möglich ist, bemühe ich das Telefon, weil diese Art der Kommunikation wesentlich effizienter ist. Ich fühle mich etwas „genervt“.
Vielleicht ist es bei Ihnen gerade anders herum, vielleicht liegt ihnen keine der Alternativen oder sie „mögen“ beide. Entscheidend ist, dass wir alle Tätigkeiten kennen, die uns um ihrer selbst Willen Spaß machen. Und auf der anderen Seite Tätigkeiten, zu denen wir uns zwingen müssen, weil wir spüren, dass sie wichtig sind und ihre Ergebnisse entscheidend sein könnten – für uns oder für andere.
Psychologen sprechen im ersten Fall von „intrinsischer Motivation“: Tätigkeiten, die uns intrinsisch motivieren, sind sozusagen Selbstzweck. Wir würden sie aus purer Freude ausführen, selbst wenn wir nichts dafür bekämen. Tennis oder Fußballspielen, Klatsch und Tratsch austauschen, sich (zeitweise) mit Kindern beschäftigen oder Singen gehören für viele Menschen dazu. Kurz: Intrinsische Motivation kommt aus der Tätigkeit selbst.
Dagegen kommt „extrinsische Motivation“ aus Quellen, die außerhalb der Tätigkeit und uns selbst liegen. Routineaufgaben und Hausarbeit gehören dazu, aber auch zum Beispiel viele Aktivitäten, die wir unternehmen, wenn wir eine Diät machen oder unsere Kinder ausbilden oder generell Probleme in Beruf und Privatleben lösen.
Im Allgemeinen empfehlen Psychologen, sich wo möglich intrinsisch motivierende Tätigkeiten zu suchen und diese auszuleben. Wie kommt man zu diesen Tätigkeiten? Die einfachste und zugleich wirksamste Strategie ist, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihnen eine (Berufs-)Tätigkeit wirklich Spaß macht, probieren Sie es aus oder stellen Sie sich diese Tätigkeit mit allen Sinnen und sämtlichen zugehörigen Situationen vor. Was fühlen Sie? Ein angenehmes Kribbeln und den Wunsch, loszulegen oder ein unangenehmes Ziehen und die Tendenz, von der Idee Abstand zu nehmen?
Für Eltern, Führungskräfte und Coaches ist es in der Regel entscheidend zu wissen, was Ihre Kinder/Mitarbeiter/Klienten intrinsisch motiviert. Denn ein Ergebnis zieht sich wie ein roter Faden durch die Motivationsforschung: Intrinsisch motivierte Personen sind nicht nur zufriedener, sondern auch durchweg erfolgreicher in dem, was sie tun.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Psychologische Begriffe: Der ‚Sleeper-Effekt‘.
Der von den Kommunikationsforschern Hovland, Lumsdaine und Sheffield (1949) eingeführte Begriff ‚Schläfer-Effekt‘ hat nichts mit Terrorismus oder Verbrechen zu tun.
Er bezeichnet eine erstaunlich wirksame Erinnerungsverzerrung, bei der sich die wichtigsten Inhalte einer Botschaft mit der Zeit immer mehr durchsetzen und unsere Einstellungen und Ansichten beeinflussen, während unwichtige Dinge oder die Quelle, aus der die Botschaft stammt, mit der Zeit von selbst vernachlässigt werden.
Ganz konkret: Stellen Sie sich vor, sie nehmen an einem tatsächlich durchgeführten Experiment von Gruder und Kollegen teil, die die Hovland’sche Theorie überprüfen wollen. Sie bekommen einen Text vorgelegt, dessen Inhalt gegen die 4-Tage-Woche spricht. Am Ende des Textes erhalten Sie jedoch einen kurzen Hinweis, dass die Quelle, aus der der Text stammt, unglaubwürdig ist und zusaätzlich ein Statement für die 4-Tage-Woche. Werden Sie gleich nach dem Experiment gefragt, was Sie von der 4-Tage-Woche nun halten, wird ihre Meinung neutral oder geteilt sein. Eigentlich hatten Sie gute Argumente gegen die 4-Tage-Woche gelesen, die Sie vermutlich durchaus teilen. Andererseits ist scheinbar die Quelle, aus der die Informationen stammen, unglaubwürdig.
Bittet man Sie allerdings nach ein paar Wochen noch einmal ins Labor und befragt Sie zur 4-Tage-Woche, so passiert Erstaunliches: Ihre Einstellung zur 4-Tage-Woche wird sich über die Zeit verändert haben. Sie sind nun mit großer Wahrscheinlichkeit gegen die 4-Tage-Woche eingestellt, wenn Sie nicht schon meinungsmäßig vorbelastet waren. Warum?
Die Erklärung: Die aufgenommenen Argumente gegen die 4-Tage-Woche ’schlafen‘ in Ihrem Gedächtnis, sobald Sie gut genug eingelesen worden sind. Während diese wohlgelernten und -durchdachten Informationen also gut gespeichert sind, ist mit großer Wahrscheinlichkeit die kurze Information für die 4-Tage-Woche vergessen. Ebenso nicht mehr präsent ist die ‚unglaubwürdige‘ Quelle, von der die Information stammt.
Was Ihnen somit nach der langen Zeit, in der Sie viele andere wichtige Informationen verarbeiten mussten, nur noch einfällt, ist: Der ‚Fakt‘, dass die 4-Tage-Woche schlecht ist und die 2-3 besten Argumente dafür.
Heute erklären Forscher das Phänomen der schlafenden Informationen mit der ‚Abkopplungshypothese‘: Speichert man Infomation A zusammen mit Gegeninformation B und Quelle X, werden mit der Zeit zunächst A und B von X im Gedächtnis getrennt. Zusätzlich bewirkt B, dass wir alle Argumente von A nochmals bewusst oder unbewusst durchdenken und damit A noch stärker gewichten. Mit der Zeit verdrängt A dann die schwächere Information B völlig aus dem bewusstseinszugänglichen Gedächtnis.
Sparen Sie also nicht mit ‚Bedenken‘, wenn Sie jemanden langfristig von einer Sache überzeugen wollen. Der kleine Hinweis am Ende Ihrer Argumentation: ‚Es könnte aber auch sein, dass Sache X sich ganz anders verhält…‘ bewirkt bei ihrem Kommunikationspartner, dass er Ihre ursprünglichen Argumente langfristig noch besser verinnerlicht.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Psychologische Begriffe: „Empty Nest Syndrom“
Wenn Kinder flügge werden und aus der Familie wieder eine Zweierbeziehung wird.
Der Auszug der eigenen Kinder hinterlässt nicht nur bei diesen selbst tiefe psychologische Spuren (die man als notwendigen Reifeprozess auffasst), sondern auch und vor allem bei den Eltern. Mütter und Väter erleben dabei das Verlassenwerden von den Kindern teilweise recht unterschiedlich. Für beide (gemeinsam) ergeben sich natürlich gavierende Vor- und Nachteile. Das allmähliche Gewahrwerden der Veränderungen durch die Eltern und die typischen Reaktionen darauf bezeichnet man als „Empty Nest Syndrom“.
 Mütter reagieren auf das Verlassenwerden gleichermaßen negativ wie positiv. Zu den negativen psychischen Folgen gehören der Verlust an ‚Lebenssinn‘, den das Aufziehen eines Kindes bedeutet. Damit einhergehend Verlust an Selbstwertgefühl, Zukunftsängste und depressive Verstimmung.
Mütter reagieren auf das Verlassenwerden gleichermaßen negativ wie positiv. Zu den negativen psychischen Folgen gehören der Verlust an ‚Lebenssinn‘, den das Aufziehen eines Kindes bedeutet. Damit einhergehend Verlust an Selbstwertgefühl, Zukunftsängste und depressive Verstimmung.
Fest steht: Je intensiver die Mütter mit der Erziehung des Kindes beschäftigt waren und je weniger Wert sie auf andere sinngebende Aufgaben, wie eine haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit gelegt haben, desto schwerer tun sie sich mit dem Auszug des Kindes und desto länger dauert auch die Phase der ‚Sinnkrise‘, die fast alle Mütter zunächst durchmachen.
Daten des statistischen Bundesamtes (2002) zeigen allerdings, dass die meisten Mütter den Auszug des Kindes nach einigen Wochen mehr als Ent-, denn als Be-lastung ansehen. Die neu hinzugewonnene Zeit und vor allem das Nachlassen des Gefühls der Verpflichtung gegenüber dem eigenen Nachwuchs geben dann den notwendigen psychologischen Freiraum, neue identitätsstiftende Tätigkeiten zu suchen. Wiederaufnahme der Berufstätigkeit, Wahrnehmen ehrenamtlicher Tätigkeit oder nachbarschaftliches Engagement wirken oft positiver als Kindererziehung auf das eigene Selbstwertgefühl – weil diese Tätigkeiten nicht gleichermaßen mit Stress und Zukunftsangst verbunden sind.
Bei Vätern fällt der Auszug der Kinder oft mit dem sogenannten ‚Time-Shift‘ zusammen: Die Väter sind am Ende der Karriereleiter angekommen, haben längst ihre berufliche Situation gefestigt und ziehen sich eventuell langsam aus dem Berufsleben zurück. Eigentlich hätten sie jetzt wieder mehr Zeit für die Familie, doch ausgerechnet jetzt ist da keine klassische Familie mehr. Väter haben somit sehr oft zunächst das Gefühl, etwas verpasst zu haben oder in der wichtigsten Zeit ‚weg‘ gewesen zu sein. Dem entsprechend entwickeln sie Schuldgefühle.
Sehr oft kompensieren Väter diese Schuldgefühle, indem sie sich umso mehr um die eigenen Enkelkinder kümmern. Damit leben sie die Vaterrolle noch einmal aus und verlieren allmählich das Gefühl, den eigenen Nachwuchs zeitweise ‚vernachlässigt‘ zu haben.
Lesen Sie morgen, welche Auswirkungen das ‚Empty Nest Syndrom‘ auf die Partnerschaft hat und wie es gemeinsam bewältigt werden kann.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quellen: Papastenfanou, Christiane (1997): Auszug aus dem Elternhaus. Aufbruch und Ablösung im Erleben von Eltern und Kindern
Statistisches Bundesamt (2002) (Hrsg.): Datenreport 2002, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn
Psychologische Begriffe: „Prospect Theory“
Bis in die späten 70er Jahre des letzten Jahrhunderts war die wissenschaftliche Psychologie weitgehend darum bemüht, das Entscheidungsverhalten des Menschen rational zu erklären: Der Mensch als ‚homo oeconomicus‘, der seine privaten, beruflichen, finanziellen und sozialen Entscheidungen an einem Kosten-Nutzen-Kalkül ausrichtet. Oder genauer: An einem „Erwartungs x Wert – Modell“.
So einfach und schön diese Theorie sein mag, so ungenau spiegelt sie auch unsere komplexe Realität wieder. Und so beschäftigt sich die ‚Verhaltensökonomik‘ – eine relativ junge Disziplin, die das Zusammenspiel von wirtschaftlichen und psychologischen Faktoren untersucht – heute vorwiegend mit zunächst ‚irrationalem‘ Verhalten von Menschen und Märkten.
Die Rennaissance aller wissenschaftlichen Überlegungen zum ‚homo irrationalis‘ wurde 1979 von den Psychologen Daniel Kahnemann und Amos Tversky angekurbelt. Sie veröffentlichten einen Artikel mit dem Titel „Prospect Theory: Decision Making under Risk“. Mathematisch akribisch und experimentell evidenzbasiert legen die beiden späteren Nobelpreisträger darin wissenschaftliche Belege vor, dass das menschliche Entscheidungsverhalten einigen gut beschreibbaren Verzerrungen unterliegt.
Dabei geht es nicht um solche Entscheidungen, bei denen alle Informationen (Alternativen, Kosten, Nutzen) bekannt sind, sondern um die weitaus häufigeren Entscheidungen unter Risiken und Unsicherheit: Sollen wir unser Eigenkapital erhöhen? Soll ich nachgeben oder auf meinem Standpunkt beharren? Wie wirkt sich das Joint-Venture mit Firma X auf unseren Unternehmenserfolg aus? Kind oder Karriere? Noch ein Bier? Rote oder schwarze Schuhe?
Die Botschaft der Prospect-Theorie (für die es keine einheitliche dt. Übersetzung gibt – die gelungenste Übersetzung für ‚Prospect‘ wäre wohl ‚Wahrnehmungsperspektive‘) lautet: Menschen machen bei jeglichen Entscheidungen unter Unsicherheit systematisch Fehler, weil sie selbst ihre eigene Wahrnehmung verzerren und nach einfachen Daumenregeln vorgehen, die mal falsch und mal richtig sein können.
In wissenschaftlichen experimentellen Studien zur Prospect-Theorie werden zumeist wirtschaftliche Entscheidungsszenarien untersucht, weil dort relativ einfach und eindeutig Gewinne und Verluste quantifiziert werden können, welche die Folge unterschiedlicher Entscheidungsstrategien sind. Und selbst in diesen berechenbaren Szenarien wird klar: Bei den wenigsten Entscheidungen können wir alle möglichen Faktoren derart berücksichtigen, dass wir sicher sein können, die optimale Entscheidung getroffen zu haben. Allerdings: Wir machen teilweise krasse Fehler, die wir eigentlich vermeiden sollten (und können!).
Obwohl die meisten Untersuchungen zur Prospect-Theorie aus dem wirtschaftlichen Kontext stammen, gilt die Theorie jedoch für alle Bereiche unseres Entscheidungs-Lebens. Die Zeit ist also reif, dass Sie ein paar dieser Fehler kennen lernen, um sie in Zukunft zu vermeiden. Start: morgen. Ab jetzt können Sie gerne jeweils Donnerstags unsere kleine Serie ‚Besser entscheiden mit Psychologie‘ nutzen. Viel Spaß beim Experimentieren mit den Ergebnissen der Verhaltensökonomik!
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Psychologische Begriffe: „Aktives Zuhören“
Versuchen Sie folgendes Experiment: Lassen Sie sich von einem Menschen (den Sie nicht allzu gut kennen sollten) etwas erklären und hören Sie ihm dabei mit versteinerter Miene und ohne sich großartig zu bewegen zu. Geben Sie keine verbalen Rückmeldungen, wie ‚ja‘, ‚achso‘ oder ‚hm‘. Beobachten Sie die Reaktionen Ihres Gegenübers. Wie lange glauben Sie, wird das Gespräch dauern und was erwarten Sie, wird das Ergebnis des Gesprächs sein?
Ganz davon abgesehen, dass Sie es mit den Worten von Paul Watzlawick nicht schaffen werden, nicht zu kommunizieren: Das ‚Gespräch‘ wird nicht länger dauern als bis zu dem Moment, in dem sich (oder Sie) Ihr Gegenüber ernsthaft fragt, was mit Ihnen los ist. Und ergebnislos verlaufen. Warum eigentlich?
Auch beim Zuhören kommunizieren wir. Ununterbrochen geben wir verbale und nonverbale Signale von uns, die unseren Gesprächspartnern zeigen: Wir sind bei ihnen, wir können (nicht) folgen, wir sind da ganz anderer Meinung, wir mögen sie (nicht). Unsere Gesprächspartner brauchen dieses Feedback, um mit uns kommunizieren zu können.
Aktives Zuhören bedeutet also ‚kommunizieren, auch wenn man gerade nicht mit Reden an der Reihe ist.“ Vor allem geht es dabei darum, dem Gegenüber die eigenen emotionalen Reaktionen zu zeigen, damit er adäquat darauf reagieren kann. Das authentische Zeigen der eigenen Gefühle schafft automatisch Vertrauen – unser Gegenüber ‚weiß, woran er ist.‘
Natürlich ist Aktives Zuhören trainierbar. Im ersten Schritt sollte man sich einmal selbst beobachten während man kommuniziert. Legen Sie dabei Ihren Fokus auf Ihre Mimik, dann auf Ihre Hände, dann auf Ihre Körperhaltung und dann auf Ihr Blickverhalten. Beobachten SIe, wie sich Ihr Gesprächspartner verhält, wenn Sie bestimmte verbale oder nonverbale Rückmeldungen geben – also zum Beispiel einmal bewusst wegsehen, die Arme verschränken, nicken, ihm mit großen Augen folgen und so weiter.
Aktives Zuhören wurde erstmals vom Psychotherapeuten Carl Rogers systematisch beschrieben und eingesetzt. Er nennt außerdem 3 notwendige Voraussetzungen für gelungene Kommunikation:
- Empathische (einfühlende, mitfühlende) und offene Grundhaltung
- Authentisches Auftreten und kongruentes Auftreten (Sprache, Mimik, Gestik und Körperhaltung müssen dasselbe ausdrücken – nicht ‚ja‘ sagen, Arme verschränken und Kopf schütteln)
- Akzeptanz und bedingungslose positive Betrachtung des anderen.
Neben diesen 3 Grundhaltungen und der nonverbalen Kommunikation ist natürlich auch wichtig, was Sie beim Aktiven Zuhören sagen: Sie können das Gespräch beim Aktiven Zuhören auch mit Ihren Äußerungen bewusst steuern. Hier zwei wichtige Tipps:
- Fragen Sie ab und zu an wichtigen Stellen nach. Wichtig wird es immer dann, wenn der Gesprächspartner Dinge besonders betont, seine Gestik ausladender wird, seine Mimik und sein Blick intensiver. Kleine Fragen, die Interesse signalisieren zeigen dem Gesprächspartner auch, dass Sie seine wichtigsten Anliegen verstehen (sie müssen sie deshalb noch nicht teilen!)
- Paraphrasieren Sie. Wiederholen Sie, in eigenen Worten und wenn Sie an der Reihe sind, die wichtigsten Punkte, die Ihr Gesprächspartner betont hat. Er wird sich automatisch verstanden und wertgeschätzt fühlen.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Psychologische Begriffe: „Wohlstandsparadox“
„The best things in life are free“ lautet ein bekanntes Sprichwort. Was kümmert uns also das Kapital, das wir täglich anhäufen, umschichten, gewinnen, verlieren, vermehren, anlegen und ausgeben? Natürlich brauchen wir „genug zum Leben“. Und dieses „genug“ wird eben objektiv in Euro, Dollar oder Rubel gemessen. Wie steht es aber mit dem subjektiven „Genug“, der Lebenszufriedenheit und dem Glück, das wir uns in unserer halb sozial, halb marktwirtschaftlich orientierten Kultur scheinbar oft kaufen müssen?
Die Gretchenfrage „Macht Geld glücklich?“ wird von unseren Forschern mit einem klaren „Es kommt darauf an!“ beantwortet. Als Wirtschaftswissenschaftler Mitte des vergangenen Jahrhunderts erstmals systematisch den Zusammenhang von Einkommen und subjektivem Glücksempfinden untersuchten, stießen sie bei ihren Langzeitstudien auf einen unerwarteten Befund: Obwohl sich die Kaufkraft der Menschen innerhalb von 50 Jahren durchschnittlich verdoppelte, wurden sie NICHT glücklicher. Dem Phänomen gaben die Forscher den Namen „Wohlstandsparadox“.
Sie nahmen an, dass nicht unser absolutes Einkommen über unser Wohlbefinden entscheidet, sondern vielmehr das relative Einkommen, also die materiellen Güter, die wir in größerem oder kleinerem Umfang besitzen als relevante andere Menschen. Ein Experiment der Universität Harvard illustriert das anschaulich: Studenten sollten sich dort entscheiden, ob sie lieber in einer Welt leben wollten, in der sie 50.000$ im Jahr verdienten und alle anderen nur 25.000$ oder in einer Welt, in der sie 100.000$ verdienten, alle anderen aber 250.000$. Wie würden Sie entscheiden. Die Studenten waren sich jedenfalls relativ einig und entschieden sich für die erste Welt.
In Europa liegt die Einkommensgrenze, ab der wir nicht mehr glücklicher werden, derzeit bei 2000€ netto pro Monat. Wer lediglich 1000€ netto verdient, wählt auf der Glücklichkeitsskala druchschnittlich einen Wert von 66%. Bei 2000€ sind es bereits 79%, danach erhöht sich das Glück offensichtlich nicht mehr. Die Wirtschaftswissenschaftler folgern: Materieller Wohlstand besitzt einen abnehmenden Grenznutzen. Und sie überlassen das Feld einer neuen wissenschaftlichen Disziplin: Der Empirischen Glücksforschung.
Diese ist nun in der Lage, das Wohlstandsparadox weitgehend aufzuklären: Jeder Mensch besitzt zunächst einmal einen „Sollwert“ seines individuellen Glücksempfindens und eine gewisse individuelle Bandbreite, innerhalb derer sich der momentane Glückswert befindet. Sollwert und Bandbreite sind weitgehend neurophysiologisch und damit genetisch festgelegt. Herr Müller hat z.B. einen Sollwert von 75% und befindet sich (vorausgesetzt es fanden keine wirklich gravierenden Lebensereignisse statt, wie Krieg, schwere Krankheit oder Verlust einer geliebten Person) zum Zeitpunkt X irgendwo in seiner persönlichen Bandbreite, zwischen 65% und 85%. Es ist also möglich, dass sich Herr Müller dauerhaft auf durchschnittlich 85% des maximalen Wohlbefindens aufhält, er wird aber niemals dauerhaft 100% erreichen, denn darauf ist sein Gehirn nicht ausgelegt. Unterstützt wird diese „Solllwert-Theorie“ durch Ergebnisse aus der Zwillingsforschung.
Forscher wie der Linzer Professor Dr. Brandstätter und der Harvard-Psychologe Tal Ben-Shahar setzen sich seit Jahren dafür ein, den Wohlstand eines Landes nicht länger mit Bruttoinlandsprodukt oder Pro-Kopf-Einkommen anzugeben. Statt dessen sei es sinnvoller, einen Befindlichkeitsindex zu verwenden, der Glück, Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit der Mitglieder zuverlässig zusammenfasst. Ben-Shahar spricht im Zusammenhang mit Glück von der „grundlegenden Währung“ – alle anderen materiellen Bemessungsgrundlagen seien zweitrangig und nur Mittel zum Glück.
Zudem sind sich Wirtschaftswissenschaftler und Glücksforscher einig: Menschen gewöhnen sich sehr schnell an höhere materiellen Standards. Lottogewinner sind beispielsweise nach circa einem Jahr wieder so (un-)glücklich wie zuvor. Dieses Phänomen wird als „hedonistische Tretmühle“ bezeichnet und impliziert, dass wir immer mehr brauchen, um unser Glücksniveau zu halten. Nach dem Luxusauto brauchen wir sozusagen die Luxusyacht, um uns noch einmal einen ähnlichen Glücksschub zu verpassen wie beim Autokauf.
Fazit: Reich werden macht nicht glücklich. Reicher werden aber sehr wohl. Zumindest kurzfristig.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer