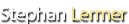Die Lücke zwischen Intention und Handlung schließen: So klappt’s mit den guten Vorsätzen
Neujahrstag – der Beginn eines neuen Jahres und für viele auch ein Tag mit besonderer Bedeutung. Denn viele beginnen das Jahr mit guten Vorsätzen. Doch egal ob man sich vornimmt, mehr Sport zu treiben, mit dem Rauchen aufzuhören, regelmäßiger und mehr zu schlafen, mehr mit der Familie zu unternehmen und weniger zu arbeiten – die meisten dieser guten Vorsätze finden ihr jähes Ende spätestens dann, wenn nach den Feiertagen der Alltag wieder beginnt.
Eine englische Studie mit 3.000 Teilnehmern ergab, dass 88 Prozent der Menschen ihre guten Vorsätze nicht einhalten. Dabei sind viele dieser Vorsätze durchaus sinnvoll. Was aber passiert auf dem langen Weg von der Intention zur Handlung, das so viele Menschen daran scheitern lässt, ihre Vorsätze auch in die Tat umzusetzen? Dr. Ralf Schwarzer, Psychologe und Professor für Gesundheitspsychologie an der Freien Universität Berlin, hat ein Modell entwickelt, anhand dessen dieser lange Weg und die vielen Hindernisse, die dem Handeln entgegenstehen, aufgezeigt werden können. Das Modell schildert nicht nur Hindernisse, sondern zeigt auch Möglichkeiten auf, diese zu überwinden.
Intentionsbildung – Klarheit schaffen
Das von Dr. Schwarzer entwickelte HAPA-Modell (Health Action Process Approach) teilt den langen Weg zwischen Intentionsbildung und tatsächlicher Handlung in drei Phasen. In der ersten Phase, der Intentionsbildung, ist vor allem Klarheit wichtig. So reicht es nicht, sich einen diffusen Vosatz vor Augen zu halten, wie z.B.: „Ich will mehr Sport machen.“ Vielmehr fordert das Modell gleich hier zu differenzieren: „Was bedeutet „mehr“?“ „Welche Art von Sport?“ „Warum halte ich das überhaupt für nötig?“ Diese Fragen können dabei helfen, Klarheit zu schaffen. Genaue Handlungs-Ergebnis-Erwartungen zu formulieren, wie: „Ich will bewirken, dass ich mich nach dem Treppen steigen nicht mehr völlig kaputt fühle,“ sind ebenso wichtig, wie eine konkrete Risikowahrnehmung. Hierfür hilft ein Gespräch mit dem Hausarzt, der die Gefahren von zu seltener Bewegung für Herz und Kreislauf eindrücklich schildern wird.
Planen und Selbstwirksamkeit schaffen
Mit der Intentionsbildung ist ein wichtiger Schritt getan. Doch der Weg bis zur Handlung ist noch weit. Die nächste Phase im HAPA-Modell ist die Planungsphase. Hierin sollte nicht nur die Ausführung genau geplant sein, sondern auch gleich überlegt werden, welche Hindernisse der Ausführung im Wege stehen könnten und wie diese überwunden werden können. Bei der Ausführungsplanung ist es wichtig, sich verbindliche und konkrete Ziele zu setzen, und dennoch einen realistischen Spielraum zu lassen. Beim Beispiel Sport könnte ein solcher Plan z.B. folgendermaßen lauten: „Ich werde ein Mal am Wochenende und ein Mal am Dienstag oder Mittwoch in der Mittagspause joggen (jeweils mindestens 30 Minuten) und mindestens ein Mal pro Woche Radfahren nach der Arbeit.“
Bei der Bewältigungsplanung sollen konkrete Gegenstrategien für eventuelle Hindernisse entwickelt werden: Was tun bei schlechtem Wetter, bei Muskelkater? Was könnte meinen Vorsätzen noch im Weg stehen? Das genaue Durchdenken dieser Hindernisse und ihre – vorläufig zunächst gedankliche Überwindung – helfen, die Selbstwirksamkeit zu stärken, d.h. das Gefühl zu entwickeln, es wirklich schaffen zu können: „Das Wetter könnte zwar besser sein und die optimale Funktionskleidung ist noch nicht zusammengestellt, aber ich starte jetzt und bestärke mich dadurch in der Überzeugung, dass ich es schaffen werde.“
Handeln – und immer wieder neu anfangen
Die letzte Phase des HAPA-Modells beschreibt die tatsächliche Handlung. Allerdings bedeutet das einmalige Beginnen nicht, dass man es automatisch schafft, auch dabei zu bleiben. Dr. Schwarzer beschreibt daher diese Phase mit einem stetigen Kreislauf aus Initiative, Aufrechterhaltung und Wiederaufnahme. Die eigene Erfolgskontrolle (z.B. durch Trainingstagebücher oder sportpraktische Testverfahren zur Leistungskontrolle) ist hier sehr hilfreich, um weiterhin motiviert zu bleiben. Doch bei aller Motivation kann es passieren, dass es einmal nicht klappt, den guten Vorsatz in die Tat umzusetzen. Gerade dann ist es wichtig, nicht aufzugeben. Denn Handeln bedeutet oft auch: immer wieder Anfangen und sich durch Rückschläge nicht entmutigen zu lassen.
Der Weg von der Intention zur tatsächlichen Handlung ist oft weit, und Hindernisse tauchen plötzlich auf wie extra gerufen. Doch wer genau weiß, was er/sie will, wer genau plant und Strategien entwickelt und vor allem wer sich nicht davor scheut, immer und immer wieder aufs Neue anzufangen, der schafft es dann, seine Vorsätze auch in die Tat umzusetzen.
Quellen:
Muster, M. & Zielinski, R. (2006). Bewegung und Gesundheit: gesicherte Effekte von körperlicher Aktivität und Ausdauertraining. Berlin: Springer.
Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy in the adoption and maintenance of health behaviors: Theoretical approaches and a new model. In R. Schwarzer (Hrsg.). Self-efficacy: Thought control of action (S. 217-243). Bristol, PA: Taylor & Francis.
Schwarzer, R., Luszczynska, A., Ziegelmann, J. P., Scholz, U. & Lippke, S. (2008). Social-cognitive predictors of physical exercise adherence: three longitudinal studies in rehabilitation (Vol. 27, No. 1S, p. S54). American Psychological Association.
Selbsteinschätzung: Wie gut kennen wir uns selbst?
Wer sich beruflich orientieren will, sollte in der Lage sein, seine Fähigkeiten, Potentiale und Interessen realistisch einschätzen zu können. Auch im Privatleben ist diese Fähigkeit wichtig: Sie hilft, eigene Entwicklungsfelder zu entdecken und sich individuell oder auch gemeinsam als Paar weiterzuentwickeln. Ergebnisse der psychologischen Forschung zeigen jedoch, dass sich viele Menschen mit Selbsterkenntnis schwer tun.
Selbstverständnis und –erkenntnis sind wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Selbstfindung: Nur wer seine Stärken und Schwächen richtig einschätzen kann und seine Interessen kennt, kann es schaffen, langfristig glücklich zu sein – ob im richtigen Beruf, der Partnerschaft oder in der Freizeitgestaltung. Zwei Studien zum Thema Selbstkonzept präsentieren jedoch eher ernüchternde Ergebnisse, denn offensichtlich fällt es vielen Menschen schwer, sich selbst richtig einzuschätzen.
Fehlerhafte Selbsteinschätzung
Die Psychologen Ethan Zell und Zlatan Krizan der Universitäten in North Carolina und Iowa State fassten kürzlich 22 Metaanalysen mit insgesamt mehr als 200.000 StudienteilnehmerInnen zusammen, die die Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzungen eigener Fähigkeiten und objektiven Leistungsmaßen untersuchten. Im Gegensatz zur weitläufigen Meinung konnten sie nur einen mäßigen Zusammenhang finden, denn oft waren die StudienteilnehmerInnen nicht in der Lage, ihre Fähigkeiten in den Bereichen akademische Kompetenz, Intelligenz, Sprachkompetenz, medizinische Kenntnisse, sportliche und berufliche Fähigkeiten korrekt einzuschätzen. Nur wenn nach spezifischen Kenntnissen gefragt wurde und die Leistungstests den ProbandInnen vorher bekannt waren, stimmten Selbsteinschätzung und objektiv gemessene Leistung stärker überein. Wurde dagegen nach Einschätzung der eigenen Fähigkeiten in weiteren Sinn gefragt, lagen die ProbandInnen mit ihrer Einschätzung weit daneben: Sie schätzten sich entweder für sehr viel besser oder sehr viel schlechter ein, als sie tatsächlich waren.
Erkenntnis der fehlerhaften Selbsteinschätzung kann Selbstbewusstein erschüttern
Die Ergebnisse der Studie von Robert Arkin und Jean Guerrettaz der Ohio State University gehen darüber noch hinaus: Sie zeigen, dass die Erkenntnis der eigenen fehlerhaften Einschätzung das Selbstbewusstsein stark erschüttern kann. Für ihre Studie befragten die beiden Psychologen ihre TeilnehmerInnen zunächst, wie sicher sie sich ihrer Selbsteinschätzung seien. Daraufhin teilten sie sie in zwei Gruppen auf: eine Gruppe mit ProbandInnen, die sich sicher waren, sich selbst gut zu kennen und eine mit TeilnehmerInnen, die sich ihrer selbst eher unsicher waren. Im nächsten Test wurden die ProbandInnen gebeten, zehn Charaktermerkmale zu nennen, durch die sich besonders auszeichnen und diese nach Wichtigkeit zu ordnen. Für die als besonders wichtig empfundenen Eigenschaften sollten die StudienteilnehmerInnen im Anschluss konkrete Beispiele aus ihrer Biografie nennen, um sie zu belegen. Besonders diese Aufgabe fiel den meisten der TeilnehmerInnen schwer, auch jenen, die zuvor angaben, sich selbst gut zu kennen. Wurden die ProbandInnen dann mit den Ergebnissen der Tests konfrontiert, zeigte vor allem die Gruppe, die zuvor angegeben hatten, sich gut einschätzen zu können, ein erheblich erschüttertes Selbstbewustsein.
Feedback einfordern
Die genannten Ergebnisse sind sicherlich ernüchternd. Die von Sokrates übermittelte Formel: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, scheint auch auf das Wissen über das eigene Selbst zuzutreffen. Im Gegensatz zur Selbsteinschätzung zeigt die Fremdeinschätzung jedoch sehr oft zutreffendere Ergebnisse. Um sich also seiner Selbst sicherer zu werden, kann es hilfreich sein, sich von anderen einschätzen zu lassen. Ob privat oder beruflich: eine Feedbackkultur, bei der das Gegenüber kontinuierlich und konstruktiv gespiegelt wird, scheint auf dem Weg der Selbsterkenntnis hilfreicher zu sein, als sich auf die eigene und oft fehlerhafte Einschätzung seiner Kenntnisse und Fähigkeiten zu verlassen.
Fazit: Ehrlich Freundschaften pflegen.
Quellen:
Frey, D. (2000). Kommunikations-und Kooperationskultur aus sozialpsychologischer Sicht. In: H. Mandl & G. Reinmann-Rothmeier (Hrsg.) Wissensmanagement. Informationszuwachs-Wissensschwund, (S. 73-92). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
Guerrettaz, J., & Arkin, R. M. (2015). Who Am I? How Asking the Question Changes the Answer. Self and Identity, 14(1), 90-103.
Zell, E., & Krizan, Z. (2014). Do people have insight into their abilities? A metasynthesis. Perspectives on Psychological Science, 9(2), 111-125.
Kriminalität und Terroranschläge: Glückliche Paarbeziehungen helfen, der Angst zu begegnen
Die Nachrichten über neue Terroranschläge versetzen die Welt in Angst und Schrecken. Seit Jahren untersuchen Psychologen Faktoren, die helfen, mit Bedrohungen umzugehen. Einer dieser Faktoren ist eine glückliche romantische Beziehung.
Nach den Terroranschlägen in Paris wächst die Angst vor weiteren Anschlägen und Kriminalität. Bedrohungsgefühle machen sich breit, sie führen zum Wunsch nach mehr Sicherheit, aber auch zu Vorurteilen und Hass. Das Gefühl der Machtlosigkeit und die Angst vor drohendem Unheil müssen aber – trotz dieser Geschehnisse – nicht unser Leben bestimmen. Sozialpsychologische Studien ermittelten Bewältigungsmechanismen, durch die diese Angst reduziert werden kann.
„Kulturelle Angstpuffer“
Seit fast zwanzig Jahren befassen sich Sozialpsychologen mit typischen Reaktionsmustern, die Menschen entwickeln, um mit Todesangst und dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit umzugehen. Die Terror-Management-Theorie von S. Solomon, J. Greenberg und T. Pyszczynski postuliert zwei Faktoren, durch die das Bewusstwerden der eigenen Sterblichkeit und die dadurch entstehende lähmende Angst besiegt werden kann:
Zum einen schaffen soziale Normen, höherer Sinn oder Transzendenz – kurz: die kulturelle Weltanschauung – eine Struktur und Wertestandards, die uns ein Gefühl von Sicherheit geben.
Der Glaube an diese kulturellen Wertestandards und die entsprechende Lebensführung können zum zweiten, dem emotionalen Faktor der Selbsterhaltung führen: dem eigenen Selbstwert.
Glückliche Paarbeziehungen als weitere „Angstpuffer“
Eine neuere Studie der israelischen Psychologen V. Florian, M. Mikulincer und G. Hirschberger erweitert die Terror-Management-Theorie um einen weiteren Faktor: Sie entdeckten die Angst reduzierende Wirkung romantischer Beziehungen.
Zum einen stellten sie fest, dass das Bewusstwerden der eigenen Sterblichkeit dazu führt, dass auch die Bindung zum/zur eigenen PartnerIn als enger empfunden wird. Andererseits reduzierten Gedanken an die enge Bindung zum/zur PartnerIn die Angst vor dem Tod. Außerdem stellten die Wissenschaftler fest, dass durch das Nachdenken über Partnerschaftsprobleme Gedanken an den Tod bewusster werden als das Nachdeken über z.B. akademische Probleme.
Eine innige und glückliche Partnerschaft hat also eine schützende Wirkung gegen existentielle Ängste.
Freiheit findet im Kopf statt
Der schweizer Autor Bernhard Steiner sagte: „Freiheit findet zur Hauptsache in unserem Kopf statt.“ Nach dem Lesen der obigen Studie möchte man dieses Zitat ergänzen: „und im Herzen“.
Quellen:
Pyszczynski, T., Greenberg, J., & Solomon, S. (1999). A dual-process model of defense against conscious and unconscious death-related thoughts: An extension of terror management theory. Psychological Review, 106, 835–845.
Florian, V., Mikulincer, M., & Hirschberger, G. (2002). The anxiety-buffering function of close relationships: evidence that relationship commitment acts as a terror management mechanism. Journal of personality and social psychology, 82(4), 527.
Wie im Coaching und Training der Placebo-Effekt die Leistungsfähigkeit steigern kann.
Es gehört zum speziellen Coaching-Stil von Dr.Lermer, dass er seinem Klienten begegnet, als wäre er bereits einen Schritt weiter in Richtung seiner Idealversion. Diese Dynamik, die sich daraus ergibt, ist mit selbsterfüllender Prophezeihung verwandt, so dass man das erfahrene Zutrauen auch erfüllt, den erhaltenen Vertrauensvorschuß nicht verspielen möchte. Ähnlich, wie wenn einem sein Mentor im Bereich Sport oder Kunst, ja überall bei relevanten Leistungen zuflüstert: Trau Dich, das schaffst Du schon! Auf diesem Gebiet wurde nun eine Studie veröffentlicht, deren Ergebnisse nicht überraschen, sondern eher wichtig sind dank ihrer wissenschaftlichen Absicherung.
Zwei Psychologen, Prof.Ulrich Weger von der Universität Witten/Herdecke und Dr. Stephen Loughnan von der Universität Melbourne schafften Klarheit: Sie gingen der Frage empirisch nach, ob jemand tatsächlich bessere Ergebnisse zeitigt, wenn er von seiner Leistungsfähigkeit überzeugt ist. Dafür wurde eine Gruppe von 40 Versuchspersonen halbiert, wobei die eine Hälfte unvorbereitet blieb. Der andere Teilgruppe wurde gezielt Selbstvertrauen suggeriert, womit sie ihrer Intuitiuon und ihrem eigenen Wissen vertrauen könnten.
Im folgenden Wissenstest lieferten die „aufgebauten“ Teilnehmer durchschnittlich 9,9 Aufgaben, die andere Hälfte kam auf durchschnittlich 8,4 richtige Lösungen. Das Wissen selbst war ja nicht trainiert worden, lediglich die mentale Haltung zu den eigenen Fähigkeiten. Hier scheint die Vorbereitung tatsächlich implizit lähmende Ängste ersetzt zu haben durch Zuversicht, die man von den Betreuern in Form von Unterstützung erfahren hatte. Prof.Weger meinte dazu wörtlich: „WIr haben ja nicht das Wissen verbessert. Aber das Gefühl von Unterstützung und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wurden gestärkt. Wir vermuten, dass sich diese Personen dannz.B. mehr angestrengt haben, besser ihre eigenen Ängste überwinden konnten, systematischer überlegt haben. Sie konnten schlichtweg das vorhandene Wissen besser abrufen und dadurch hat sich die Leistung dann tatsächlich verbessert.“
Quelle: Weger, Ulrich W., Loughnan, Stephen (2013) „Mobilizing unusual resources: Using the placebo concept to enhance cognitive performance“. The Quart.J.of Exp.Psychol. 2013, 66, 23-28
Was sind eigentlich…
…die Hauptursachen von Partnerschaftsproblemen?
1. Mangelndes Selbstvertrauen durch zu wenig Liebe und Zärtlichkeit vom Partner. Es fehlt zu häufig: „Schön, dass es dich gibt – ich mag Dich, so wie du bist…“.
2. Mangelndes Selbstbewusstsein durch zu wenig Anerkennung durch den Partner. Es fehlt zu häufig: „Du bist o.k., ich bin stolz auf Dich…“.
3. Mangelnde Kommunikationsfähigkeit. Zu häufig heißt es: „Warum kommst Du jetzt erst?“, anstatt: „Ich hatte mich schon so gefreut auf Dich!“
Tipps zur Verbesserung der Partnerschaft sind demnach:
1. Beide müssen ihr Selbstwertgefühl ins Plus bringen („Ich bin o.k.“): Durch Anerkennung über Job, Sport oder Hobby – und einen Freundeskreis pflegen, der einen auffängt, wenn man sich mit dem Partner gerade nicht versteht.
2. Beziehung heißt laufend Kompromisse eingehen: Das erfordert miteinander reden können, auch mal positiv miteinander streiten (das kann man über Bücher oder Seminare lernen).
3. Gemeinsamkeiten und verbindende Ziele geben der Beziehung Sinn (Beispiel: Bauernehen und Pastorenehen werden am seltensten geschieden): Als Gemeinsamkeit dient der selbe Name, Wohnsitz, als Paar gelten, gemeinsame Geheimnisse und Interessen etc., als verbindende Ziele wirken: Kinder, die Firma, Reisen, Hobbys etc.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Lermer, Stephan. Liebe und Lust. Mary Hahn Verlag
Anderen die Schuld zuschieben… ist ansteckend!
Anderen die Schuld für eigene Versäumnisse zuzuschieben, ist einfach, aber langfristig schädlich. Zudem ist dieses Verhalten ansteckender als die Schweinegrippe und kann das Organisationsklima innerhalb kürzester Zeit nachhaltig verschlechtern.
„Schuldzuweisungen erschaffen eine Kultur der Angst“ sagt Prof. Dr. Nathanael Fast, Psychologe an der University of Southern California in Los Angeles. In einigen Experimenten untersuchte er Dynamik und Auswirkungen von öffentlichen Schuldzuweisungen und öffentlicher (unberechtigter) Kritik. Er stellte dabei fest, dass Menschen sich schneller von schlechten Beispielen anstecken lassen, als sie selbst zugeben würden:
„Wenn wir beobachten, wie andere ihr Ego schützen, indem sie andere angreifen und ihnen die Schuld für Fehler zuschieben, beginnen wir rasch selbst damit, solche Verteidigungsstrategien zu entwickeln. Wenn wir dann unser Selbstbild schützen, indem wir anderen die Schuld geben, fühlt sich das in dem Moment gut an.“ Langfristig nähme das Ego jedoch Schaden, meint Fast. Genau wie die eigene Reputation, die Arbeitszufriedenheit und die Leistung ganzer Arbeitsgruppen und Organisationen.
Was aber tun, wenn man sein Ego bedroht sieht und die Schuld gerechterweise auf andere Schultern verteilen will?
Zunächst rät Fast zur alten Weisheit, die Schuldfrage erst einmal unter vier Augen zu klären – damit kein Außenstehender sich das Verhalten von Schuldzuweisungen und Aggression ‚abschauen‘ kann: „Loben Sie in aller Öffentlichkeit, kritisieren Sie unter vier Augen.“ Oder etablieren Sie eine Kultur, in der Fehler nicht nur toleriert, sondern als Chance zu Verbesserung und persönlicher Entwicklung wahrgenommen werden.
Fast zeigt in seinen Experimenten auch, dass ein hohes Selbstwertgefühl vor Schuldzuweisungen schützt: Versuchsteilnehmer, deren Selbstvertrauen durch ein kurzes Training gestärkt worden war, zeigten sich weitaus weniger anfällig für Schuldzuweisungen und sorgten in der Regel für ein positiveres Klima und produktivere Arbeitsbedingungen in ihrem Umfeld.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: www.eurekalert.org/pub_releases/2009-11/uosc-sbi111909.php