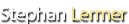Warum wir Affären haben
Aus mittelmäßigen Beziehungs-Ratgebern wissen wir: Wir sind seriell monogam, der Seitensprung ist genetisch bedingt. Soll heißen: Wir Menschen können ja gar nichts dafür, wenn wir ab und zu mit anderen in die Kiste springen. Die Konsequenz daraus: Wir müssen uns mit der Untreue des Partners / der Partnerin abfinden – Er/sie kann ja nichts dafür.
Das ist natürlich wie so oft nur die halbe Wahrheit. Wohl schlummert in jedem von uns ein potentieller „Seitenspringer“. Und die evolutionär-psychologische Erklärung, dass wir so die Chancen für gesunden Nachwuchs erhöhen und deshalb nur das tun, was für unsere Vorfahren und unsere ganze Spezies wohl überlebenswichtig ist – das ist auch plausibel. Aber für den wahren Grund, aus dem die unmittelbare Entscheidung für einen Seitensprung erwächst, braucht man im Prinzip keine komplexe Erklärung. Die Erklärung ist statt dessen recht einfach: Sexuelle Unzufriedenheit.
Das belegt eine Studie im Auftrag von Theratalk, bei der über 2500 untreue Männer und Frauen nach den Gründen ihrer Untreue gefragt wurden. Danach entscheiden sich 79% der Männer für eine Affäre, weil sie mit der Sexualität in der Partnerschaft unzufrieden sind. Bei den Frauen sind es sogar 85%. Natürlich gehen auch sexuell zufriedene Partner fremd, aber die Wahrscheinlichkeit für einen Seitensprung ist wesentlich geringer, wenn beide Partner glauben, dass es im Bett funktioniert.
Das probate Mittel gegen Seitensprünge ist daher: Prävention. Und das vor allem durch partnerschaftlicher Kommunikation über Sex und Zärtlichkeit. Die Kunst besteht darin, mit dem eigenen Partner über Wünsche und Vorlieben zu sprechen und vor allem über die Dinge offen zu reden, die stören.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: www.theratalk.de
Wie steht es um die Lust in deutschen Schlafzimmern?
Heute lassen wir einfach einmal die Zahlen sprechen und zeigen Ihnen eine Statistik, die das Ergebnis einer großen Online-Umfrage unter deutschen Paaren darstellt. Die Frage lautete: „An wie vielen Tagen in den letzten vier Wochen hatten Sie Sex mit Ihrem Partner?“
Das Diagramm zeigt recht deutlich, dass Sex mit dem Partner für die meisten ein vergleichsweise seltenes Ereignis ist. 60% haben einmal pro Woche Sex oder weniger. 27% haben gar einmal pro Monat Sex oder weniger. Bei der Studie wurden ausschließlich Personen befragt, die im genannten Zeitraum in einer festen Partnerschaft lebten.
Dabei zeigte sich auch, dass viele Paare kein Problem mit der Häufigkeit ihrer Intimkontakte hatten. Entscheidend für Partnerschaftsprobleme ist vielmehr, ob sich die Idealvorstellung von der Anzahl der Kontakte mit der Realität deckt: Will ein Partner öfter Sex als der andere, führt das zu zwangsweise zu Differenzen, die mehr oder weniger harmlos ausgetragen werden und die Partnerschaft gefährden.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: www.theratalk.de
AMEFI
Die sicherste Variante, eine Partnerschaft an die Wand zu fahren sind überzogene Erwartungen an den Partner und an die Beziehung: „Alles mit einem, für immer und ewig -AMEFI“ lautet der biologisch mitverursachte Slogan am Beginn einer Beziehung.
Und in der ersten Zeit fällt uns das leicht: Hormone und Gefühle lassen uns das Leben an der Partnerschaft ausrichten. Unsere Gedanken und Wünsche kreisen nur um das nächste Date, gemeinsame Aktivitäten, die Zeit zu zweit. Dass sich das mit der Zeit ändert, ist natürlich und für die Partnerschaft auch wichtig: Vertrauen und eine sichere Bindung nimmt den Platz der ersten Verliebtheit und der fast zwanghaften Vernarrtheit in den Partner ein – der wichtigste Schritt zu einer wirklich langfristigen Liebesbeziehung.
Schlimm nur, wenn dieser schleichende Prozess nicht akzeptiert wird. Will man doch die schönen Gefühle vom Anfang möglichst lange behalten; die Verliebtheit möglichst lange oder oft spüren; Den Sex so aufregend gestalten und erleben wie bei den ersten intimen Begegnungen.
Natürlich sollten Sie etwas tun für Ihre Partnerschaft: ein romantisches Dinner, gemeinsame Ausflüge, kleine unerwartete Geschenke lassen die anfängliche Verliebtheit immer wieder aufflammen und tragen wesentlich dazu bei, die Beziehung zu festigen. Allerdings ist es ebenso wichtig, vom anfänglichen Idealbild des Partners und der Beziehung zu einem realistischen Bild der (verlässlichen) partnerschaftlichen Bindung zu gelangen.
Was man sich auch verdeutlichen sollte: In Ländern mit geplanten Ehen ist die Partnerschaftszufriedenheit ebenso hoch wie in Ländern, in denen überwiegend aus Liebe geheiratet wird. Die Qualität einer langfristigen Partnerschaft ist also kaum von der anfänglichen Verliebtheit abhängig. Sondern eher von der Akzeptanz der Partner, der gegenseitigen Wertschätzung und der gemeinsamen Lebensplanung.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: www.geo.de
Klare Ansagen im Bett!
Nur ein Drittel aller sexuellen Wünsche deutscher Männer wird von ihren Partnerinnen erfüllt. Das klingt sehr traurig und stellt den Frauen scheinbar kein gutes Zeugnis aus. Allerdings: Göttinger Forscher gingen der sexuellen Unzufriedenheit auf den Grund und fanden Erstaunliches. Von den 66% unbefriedigten Wünschen würden die Partnerinnen wiederum über die Hälfte erfüllen – wenn sie sie nur kennen würden!
Das wiederum stellt nun den Männern ein schlechtes Zeugnis aus – ihre Beziehungen würden sexuell erfüllter, wenn sie sich nur trauten, einmal offen über ihre erotischen Wünsche zu sprechen.
Doch sie sind nicht allein.
Bei Frauen wird zwar „immerhin“ die Hälfte ihrer sexuellen Wünsche mit dem Partner Realität. Die andere Hälfte bleibt allerdings vor dem Partner geheim und wird fast ausschließlich deshalb nicht erfüllt. Männer nämlich würden auf über zwei Drittel der Wünsche ihrer Partnerinnen eingehen.
Beziehungsforscher fragen deshalb etwas provokant: Welches Geschlecht stellt sich hier eigentlich dümmer an? Und sind sich einig: Über erotische Fantasien, Vorlieben und „geheime“ Wünsche zu sprechen ist der wichtigste Faktor für die sexuelle (Un-)zufriedenheit. Und je länger man Wünsche verschweigt, desto schwieriger wird es sie anzusprechen. Fangen Sie also gleich an.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Universität Göttingen, www.theratalk.de
Was Frauen wollen
Liebe Damen, bitte werfen Sie doch einmal einen kurzen Blick (2 sekunden) auf die beiden attraktiven Herren im Bild unten!
Welcher von beiden ist attraktiver?
Wenn man einer Studie der University of Rochester glauben darf, wirken Männer mit roter Kleidung attraktiver. Eine Gruppe von Psychologen um Prof. Andrew Eliott fand diesen Effekt recht zuverlässig und deutlich ausgeprägt. Natürlich gingen sie der Frage nach, warum das so ist und fanden heraus:
Frauen ordnen Männern in Rot einen höheren Status zu – und hoher Status macht Männer bekanntlich sexy.
Aber warum ausgerechnet Rot? Eliott ist der Meinung, dass hier eine Mischung aus Genen und kultureller Prägung am Werk ist: Zunächst war rot schon immer das Zeichen der Mächtigen: Senatoren, Könige, Stammesfürsten – viele führende Personen trugen und tragen rote Kleidung und nutzen sie als ein Zeichen von Souveränität und Macht. Und wenn der rote Teppich ausgerollt wird, dürfen ihn meist nur die Mächtigsten und Begehrtesten betreten. Der biologische Faktor wird deutlich, wenn man das Verhalten von Menschenaffen beobachtet. Die Alpha-Männchen zeigen häufiger Zähne, Zahnfleisch und Rachen, sie reißen öfters den (roten) Mund auf, zeigen so ihre Dominanz und: Sie haben mehr Erfolg bei den Weibchen.
Die Forscher um Eliott berichten noch zwei weitere interessante Befunde. Erstens: Rot ließ die Männer zwar attraktiver, dominanter und begehrenswerter erscheinen. Allerdings nicht freundlicher, lieber oder umgänglicher. Und zweitens: Der Effekt trat nur bei Frauen auf. Wurden Männer gebeten, die Attraktivität anderer Männer zu schätzen, so spielte die Farbe der Kleidung keinerlei Rolle.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: University of Rochester (2010, August 3). Women attracted to men in red, research shows. ScienceDaily.
Neue Lust auf den Partner und gleichzeitig weniger Stress gewünscht?
Zwei Körper, eng umschlungen. Zwei Augenpaare, die sich verlangend ansehen. Hände, die fest zupacken. Ein gemeinsamer Rhythmus. Tango eben.
Der Tanz, der seit 2009 auf der Liste der erhaltenswerten Künste der UNESCO steht, hatte ursprünglich ein eindeutiges Ziel: Lust zu machen auf mehr. Als ‚Vorspiel‘ in den Bordellen von Buenos Aires konzipiert wurde er bald standardisiert und salonfähig gemacht. George Bernard Shaw meinte dazu, der Tango sei „der vertikale Ausdruck eines horizontalen Verlangens“.
Kein Wunder, dass der Tanz mittler Weile dazu verwendet wird, eingeschlafene Paarbeziehungen wieder aufzuwecken. Und das sogar wissenschaftlich fundiert:
Der Musikwissenschaftler Prof. Dr. Gunther Kreuz hat zusammen mit Kollegen die hormonellen Veränderungen tango-tanzender Paare untersucht und fand: Während die Konzentration des Stresshormons Cortisol beim Tanzen abnahm, erhöhte sich die Ausschüttung des Sexualhormons Testosteron. Kreutz führte etliche Versuchsreihen durch, um die Wirkung von Musik und Tanz unabhängig voneinander zu beobachten. Dabei zeigte sich, dass die Verringerung des Stresshormons vor allem über den Klang der Musik vermittelt wird, die Steigerung des Sexualhormons dagegen erst signifikant wird, wenn Körperkontakt herrscht. Allerdings: Die beiden Wirkungen potenzieren sich. Tango ist erst mit Musik so richtig effektiv und Musik ohne Tango entspannt nicht in demselben Maße.
Neben der Hormonmessung bat Kreutz seine tanzenden Versuchsteilnehmer auch um eine Einschätzung ihrer subjektiven Gefühlslage vor und nach dem Tango. Das Ergebnis: nach dem Tanzen waren die Paare nicht nur gelöster, sondern zudem auch lüsterner.
Seit einigen Jahren beschäftigt sich Kreutz mit den Auswirkungen von Musik und Tanz auf den menschlichen Körper und belegt immer wieder, dass Musikhören sowie aktives Tanzen und Singen positive Auswirkungen auf Gesundheit und emotionales Wohlbefinden haben. Außerdem behauptet er mit Überzeugung: „Tanzen und Musik stärkt unser Immunsystem“.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Quiroga, Cynthia, Stephan Bongard & Gunter Kreutz (2009). Emotional and neurohumoral responses to dancing tango argentino: The effects of music and partner. Music and Medicine, 1(1), 14-21.