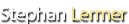Spezial zu Partnerschaft und Ehe: Konfliktstile: Gefahren und Chancen für die Partnerschaft
Der Umgang mit Konflikten ist ein entscheidender Faktor für die Entwicklung einer Partnerschaft. Der richtige Umgang mit ihnen kann zum erfreulichen Gelingen, der falsche jedoch unweigerlich zum fatalen Scheitern führen. Wie geht man nun mit Konflikten richtig um? Psychologische Studien offfenbaren, dass diese Frage stets individuell und zusätzlich nur zusammen mit dem/der PartnerIn beantwortbar ist.
Keine zwei Menschen ticken zu hundert Prozent gleich. Beim Zusammenleben sind daher Meinungsverschiedenheiten, kleinere und größere Reibereien sowie Streit geradezu unvermeidbar. Selbst dann, wenn man die gleichen Ziele, Werte und Träume teilt. Das Aufkommen eines Konflikts ist nicht gleichbedeutend mit dem drohenden Ende einer Partnerschaft – hier ist jedoch entscheidend, wie beide Partner damit umgehen. Dafür gibt es keine Patentlösung, die für alle gelten könnte. Psychologen der Universität Washington untersuchten in Langzeitstudien verschiedene Konfliktstile und deren Auswirkungen auf die Partnerschaft.
Drei markante Stile, wie Konflikte ausgetragen werden: Validators, Volatiles und Avoiders
Die Forschungsarbeit von Dr. Janice Driver und ihren Kollegen der Universität in Washington, in der über 300 Paare regelmäßig befragt wurden, ergab zunächst drei Stile, in denen Konflikte innerhalb von Partnerschaften ausgetragen werden. Sie beschreiben sie als Validators, Volatiles und Avoiders.
Bei Validators (engl. to validate: anerkennen, bestätigen, für gültig erklären) tauchen Meinungsverschiedenheiten grundsätzlich selten auf. Wenn beide ein Konfliktpotential erkennen, sprechen sie es offen und respektvoll an und sind dann schnell kompromissbereit. Sie akzeptieren die Emotionen und Ansichten ihres Partners, engen einander nicht ein und zeichnen sich durch starken gegenseitigen Respekt aus.
Bei Volatiles (engl. volatile: explosiv, brisant, verfliegend) dagegen geht es oft heiß her. Sie tragen ihre Konflikte mit Eifer aus, engagieren sich stark und leidenschaftlich. Diese Leidenschaftlichkeit zeigt sich aber nicht nur in Konfliktsituationen: Sie sind damit auch in der Lage, ihre Wärme und Zuneigung füreinander sehr deutlich auszudrücken. So schaffen sie es, die negativen Emotionen, die während eines Konflikts entstehen, im Alltag wieder auszugleichen. Für sie ist es vorrangig wichtig, in jeder Situation deutliche Worte zu finden, und das erwarten sie auch von ihrem/r PartnerIn. So begegnen sie einander – auch während eines heftigen Streits – konsequent auf Augenhöhe.
Avoiders (engl. to avoid: vermeiden, umgehen, sich enthalten) jedoch vermeiden Konflikte, wo immer es möglich ist. Sie minimieren ihre Probleme, betonen positive Aspekte und blenden negative aus, um ja keine Konflikte entstehen zu lassen und den Alltag möglichst harmonisch zu gestalten. Entstehen dennoch Probleme, die sich nicht ad hoc lösen lassen, dann einigen sie sich lieber darauf, sich nicht einigen zu können, statt sich zu streiten („let’s agree to disagree“).
Der richtige Umgang mit Konflikten: Die gleiche Augenhöhe ist wichtig
Betrachtet man die drei Konfliktstile, die Dr. Driver und ihre Kollegen beschreiben, findet man sich gar selbst in einem davon wieder, stellt sich die Frage, welcher dieser Stile denn nun der Beste sei. Andersherum betrachtet: Welcher Stil mag für eine Beziehung am wenigstens förderlich sein?
Dr. Driver und ihre Kollegen gingen zunächst von der Annahme aus, dass vor allem Avoiders, Menschen also, die Konflikte möglichst immer vermeiden möchten, im Alltag schlechte Chancen haben, ihre Partnerschaft dauerhaft glücklich zu gestalten. So waren die Forscher sehr überrascht, als ihre Ergebnisse diese Vermutung nicht bestätigten. Im Gegenteil: Keiner der beschriebenen Konfliktstile zeigte sich als besonders vorteilhaft oder ungünstig (!).
Nicht der Konfliktstil selbst entscheidet also über Erfolg oder Scheitern einer Partnerschaft, sondern die Tatsache, dass die gleiche Art, mit Konflikten umzugehen, für beide Partner funktioniert. Nur so sind Begegnungen auf Augenhöhe möglich. Genau das ist aber entscheidend. Eine Person, die Konflikte lieber ganz vermeidet, wird mit jemandem, der gern leidenschaftlich streitet, kaum zurecht kommen. Jemand, der das Bedürfnis hat, Unstimmigkeiten sofort anzusprechen, wird Vermeidungsverhalten seines/r PartnerIn womöglich als Desinteresse missinterpretieren. Ein Mensch, der all seine Gefühle leidenschaftlich auszudrücken gewohnt ist, wird in jemandem, der sofort versucht, Kompromisse zu finden, kein adäquates Gegenüber finden.
Fazit: Der gleiche Konfliktstil muss also für beide Partner passen.
Die Forschungsergebnisse, die in dem Blog-Spezial zu Ehe und Partnerschaft präsentiert wurden, lassen deutlich erkennen: Weder die Anzahl der Konflikte noch der Konfliktstil bringt eine Beziehung zum Scheitern. Vielmehr ist es die Art, wie beide mit Konflikten umgehen. Und jede Form von Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten muss anschließend durch positive Interaktionen im Alltag wieder ausgeglichen werden. Gerade der gemeinsame Alltag zählt: Respekt und Zuneigung, die beide im alltäglichen Umgang miteinander zeigen, sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Partnerschaft. Nur damit kann eine Partnerschaft auf Dauer glücklich gestaltet werden.
Quellen:
Driver, J., Tabares, A., Shapiro, A., Nahm, E. Y., Gottman, J. (2003). Interactional patterns in marital success and failure: Gottman laboratory studies. In F. Walsh (Ed.) Normal family process: Growing diversity and complexity (3rd ed., pp. 493-513) New York: Guilford Press.
Spezial zu Partnerschaft und Ehe: Die Gefahren des Alltags
In Respekt und Zuneigung während des alltäglichen Umgangs miteinander scheint tatsächlich das Geheimnis einer dauerhaft glücklichen Paarbeziehung zu liegen. Das bestätigen viele wissenschaftliche Untersuchungen unabhängig voneinander. Doch was lässt dennoch viele Paare im Alltag Schiffbruch erleiden? Aus Studien, in denen Ehepaare über lange Zeit beobachtet und befragt wurden, können nun spezifische Verhaltensweisen abgeleitet werden, die ein Scheitern der Ehe vorhersagen.
Trennung und Scheidung sind schon lange keine Seltenheit mehr: Fast die Hälfte der in Deutschland geschlossenen Ehen werden bereits nach wenigen Jahren wieder geschieden. Fragt man nach den Gründen, hört man oft die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Sicher: materielle Abhängigkeit und Ansehensverlust zwingen heute immer seltener dazu, deshalb zusammen zu bleiben. Wurden Ehen aber früher aus diesen Gründen aufrecht erhalten, bedeutete das noch lange nicht, dass die Partner auch glücklich miteinander waren. Zum Zeitpunkt der Eheschließung sind die Partner noch davon überzeugt, dass ihre Beziehung Zukunft haben wird. Wo aber liegt der Unterschied zwischen Paaren, die es schaffen, dauerhaft miteinander glücklich zu sein und solchen, die schon nach kurzer Zeit scheitern? Forscher der Universität in Washington entdeckten Verhaltensweisen, anhand derer sie diesen Unterschied erkennen können.
Die vier Vorboten des Scheiterns
Dr. Janice Driver und ihre Kollegen der Universität in Washington trugen Ergebnisse aus dreißig Jahren Forschung zusammen, in denen über 300 Paare regelmäßig befragt wurden. Durch die Auswertung dieser Ergebnisse konnte das Forscherteam spezifische Verhaltensweisen ausmachen, die sie als die „Vier Vorboten des Scheiterns“ bezeichneten. Ihre Ergebnisse lassen erkennen, dass eine Scheidung mit 94%-iger Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden kann, wenn alle dieser Vorboten bei den Partnern zu erkennen sind.
Persönliche Kritik
Persönliche Kritik, die global und als persönlicher Angriff formuliert wird, ist der erste dieser „Vorboten“. Das bedeutet nicht, dass man alles hinnehmen muss, was am Verhalten des Partners/der Partnerin stört. Konstruktives Feedback jedoch und sachliche Kritik wirken sich auf die Paarbeziehung auf Dauer stets positiv aus. Insbesondere, wenn sie nicht auf die gesamte Persönlichkeit, sondern auf spezielle Verhaltensweisen abzielen. Ist Kritik aber als Anschuldigung formuliert („Du bist so vergesslich!“) und beinhaltet sie globale Formulierungen wie „immer“ oder „nie“, führt sie zu einer Eskalation der negativen Emotionen, und die Partnerschaft nimmt langfristig Schaden.
Geringschätzung
Geringschätzende Bemerkungen, Sarkasmus, beißender Spott oder Beleidigungen tun keiner Beziehung gut. Sie sind das Gegenteil von Respekt und Zuneigung, den Qualitätsfaktoren guter Beziehungen. Stattdessen stehen sie für Empörung, Abscheu und Verachtung gegenüber dem Partner. Gleichzeitig verhindern sie die Chance zu versöhnlichen Schritten nach einem Streit. Taucht also dieser „Vorbote“ in einer Beziehung auf, ist diese stark gefährdet.
Rechtfertigung
Sich bei einer Anschuldigung oder selbst bei einem konstruktiven Feedback zunächst zu rechtfertigen ist ein weit verbreiteter Automatismus. Fatalerweise bewirken gerade Rechtfertigungen die Eskalation negativer Gefühle. Dr. Driver und ihre Kollegen raten daher, statt auch noch direkt zum Gegenangriff überzugehen und sich damit vor Angriffen und persönlicher Verantwortungsübernahme abzuschirmen, die Argumente des Gegenübers erst einmal anzuhören und sich damit vorzustellen zu können, wie sich der Partner gerade fühlt.
Abblocken
Manche Menschen tendieren dazu, bei einem Streit irgendwann „abzuschalten“: In der Hoffnung, der Partner werde sich bald wieder von allein beruhigen, versuchen sie sich zu schützen, indem sie gar nicht mehr zuhören, dem/der PartnerIn nicht mehr in die Augen schauen und weder verbal noch nonverbal reagieren. Ab diesem Moment ist selbst konstruktive Kritik wirkungslos, verpufft. Eine solche Situation fordert von beiden Partnern Fingerspitzengefühl: Abblocken gilt nicht, allein der Anstand gebietet es, seinem Partner weiterhin zumindest zuzuhören. Geht auch das nicht, ist es zielführender, wenn der Souveränere von beiden dieses situative Kommunikationsdesaster als solches erkennt und vorschlägt die Diskussion vorerst besser zu vertagen.
Der Umgang mit Konflikten erweist sich als ein entscheidender Faktor, der zum Gelingen, aber auch zum Scheitern einer Partnerschaft führen kann. Sollten Konflikte daher besser vermieden werden, um den Alltag möglichst harmonisch zu gestalten? Für manche Menschen ist die Antwort: Ja. Für die Mehrzahl jedoch muss die Antwort anders lauten. Wie genau, das wird der nächste Blog-Eintrag erklären.
Quelle:
Driver, J., Tabares, A., Shapiro, A., Nahm, E. Y., Gottman, J. (2003). Interactional patterns in marital success and failure: Gottman laboratory studies. In F. Walsh (Ed.) Normal family process: Growing diversity and complexity (3rd ed., pp. 493-513) New York: Guilford Press.
Spezial zu Partnerschaft und Ehe: Was kennzeichnet glückliche Paare?
Das verflixte vierte Jahr: Vielen Paaren stellen sich gerade in diesem Zeitraum besondere Herausforderungen, denn die körpereigenen Glücks- und Bindungshormone sinken dann auf ihren tiefsten Stand. Haben es die Partner jedoch bis zu dieser Zeit geschafft, ihre Beziehung auf ein festes Fundament zu stellen, könnte das Erhoffte gelingen, auch weiterhin glücklich miteinander zu sein. Interviews, die Forscher mit älteren und glücklich verheirateten Paaren geführt haben, offenbaren, wie.
Sehr oft konzentrieren sich Forschung und auch Lebensratgeber auf spezielle Fehler, wodurch sich Menschen unzufrieden in ihrer Partnerschaft fühlen und die Beziehung letztlich daran scheitern lassen. Oft werden biologische Prozesse, wie z.B. das Absinken der Hormone Dopamin und Oxytocin für Schwierigkeiten verantwortlich gemacht und die Folgen daraus geradezu als unvermeidlich erklärt.
Ein Beispiel: In einer Studie zum Thema sexuelle und emotionale Eifersucht kommen Forscher zu dem Schluss, dass heterosexuelle Männer ein wesentlich größeres Problem mit sexueller Untreue ihrer Partnerinnen haben, während bei Frauen die emotionale Untreue ihrer Partner zu Eifersucht führt. Als Grund wird hierfür die biologisch begründete Verunsicherung des Mannes angegeben, ob er dann nun wirklich der genetische Vater potentiellen Nachwuchses wäre. Die Frau fürchtet eher die Gefahr, die Position der first lady bei ihrem Partner zu verlieren.
Diese evolutionspsychologischen Herleitungen erscheinen zwar oft sehr plausibel, sind aber einerseits nicht beweisbar und können andererseits diese biologischen Mechanismen nicht einfach auflösen, nur weil man sie jetzt zu kennen glaubt. Der Alltag beweist jedoch: Menschen müssen diesen Mechanismen nicht hilflos ausgesetzt bleiben.
Interaktionsmuster als Kennzeichen glücklicher Paare
In einer alternativen Herangehensweise konzentrierten sich Dr. Janice Driver und ihre Kollegen der Universität in Washington auf Merkmale, die glückliche Paare kennzeichnen. In der Hoffnung, Möglichkeiten zu entdecken, wie Menschen über Jahre hinweg glücklich miteinander sein können, lag ihr Fokus auf alltäglicher und nicht konfliktgeprägter Kommunikation. Tatsächlich konnten sie in Langzeitstudien verschiedene Faktoren ausmachen, wann die Partnerschaft auf Dauer als glücklich empfunden wurde.
Zuwendung
Einer der wichtigsten dieser Faktoren scheint das zu sein, was Dr. Driver und ihre Kollegen als „Zuwendung innerhalb partnerschaftlicher Interaktion“ bezeichneten. Hierzu wurden Paare eingeladen, eine Woche lang in einem Apartment zu wohnen, um dort 12 Stunden am Tag von den Forschern beobachtet zu werden. Jede Form der Initiierung von Interaktion – ob verbal oder lediglich durch einen Blick oder eine Geste – wurde gezählt und die Reaktion des/der PartnerIn darauf beobachtet. Denn jede Initiierung einer Interaktion bietet die Möglichkeit, die Beziehung zu verbessern oder zu verschlechtern. Auf eine solche Initiierung kann positiv reagiert werden, sie kann aber auch Ablehnung hervorrufen oder völlig ignoriert werden. Bei der Auswertung ihrer Beobachtungsdaten konnten die Forscher feststellen, dass Paare, die sich zuvor als glücklich miteinander bezeichnet hatten, nicht nur deutlich öfter Interaktion initiierten, sondern dass auf diese Initiierung auch wesentlich öfter positiv reagiert wurde. Positive Reaktionen fördern die emotionale Verbundenheit und die Partnerschaft, während Ablehnung und Ignoranz zu Distanz und Unzufriedenheit führen.
Sicher ist es im Alltag nahezu unmöglich, wirklich jeden Blick, jede Geste, jedes Wort des Gegenübers zu bemerken und darauf positiv zu reagieren. Dennoch deuten die Ergebnisse von Dr. Driver darauf hin, dass glückliche Paare dies öfter schaffen – was wiederum dazu führt, auch weiterhin glücklich miteinander zu sein.
Der Alltag zählt
Bei dieser und auch vielen anderen Untersuchungen dieser Studienreihe scheint sich eine Vermutung des Forscherteams immer wieder zu bestätigen: Der Alltag zählt. Es ist der alltägliche Umgang miteinander, der darüber bestimmt, wie glücklich Menschen in ihrer Beziehung werden. Ist der Alltag nicht von Respekt und Zuneigung geprägt, werden weder teure Geschenke oder Luxusurlaube dabei helfen, die Partnerschaft dauerhaft glücklich zu erleben.
Das zeigt sich bereits bei den finanziellen Ausgaben für die Hochzeitsfeier: Forscher der Universität von Virginia stellten fest, dass Eheleute, die für ihre Hochzeit zwar auch Geld ausgegeben, aber vorrangig viele Gäste eingeladen hatten, länger und glücklicher miteinander verheiratet sind, als Paare, die lediglich eine überaus luxuriöse Feier veranstalteten, um diesen Tag zu begehen.
Die genseitige tiefe Überzeugung davon, dass der/die PartnerIn Zuneigung, Respekt und Liebe verdient, das Kennen-lernen-wollen der Welt des/der anderen sowie die Betonung und das Leben gleicher Ansichten, Werte und Ziele haben sehr wenig mit materiellen Dingen zu tun. Sie aber werden dafür sorgen, dass eine Partnerschaft das Fundament erhält, auf dem sie von beiden dauerhaft als glücklich erlebt werden kann.
Was aber lässt so viele Paare am Alltag scheitern? Der nächste Blog-Eintrag wird dies näher beleuchten.
Quellen:
Driver, J., Tabares, A., Shapiro, A., Nahm, E. Y., Gottman, J. (2003). Interactional patterns in marital success and failure: Gottman laboratory studies. In F. Walsh (Ed.) Normal family process: Growing diversity and complexity (3rd ed., pp. 493-513) New York: Guilford Press.
Francis‐Tan, A., & Mialon, H. M. (2015). “A diamond is forever” and other fairy tales: The relationship between wedding expenses and marriage duration. Economic Inquiry.
Frederick, D. A., & Fales, M. R. (2014). Upset over sexual versus emotional infidelity among gay, lesbian, bisexual, and heterosexual adults. Archives of sexual behavior, 1-17.
Spezial zu Partnerschaft und Ehe: Wie bleibt das Glück erhalten?
„Bis, dass der Tod euch scheidet“ – dieser Trauspruch gilt für viele Ehen schon lange nicht mehr. Hält eine Ehe in Deutschland länger als 15 Jahre, wird sie heute meist schon als Langzeitehe bezeichnet. Kann man bereits zu Anfang erspüren, ob eine Partnerschaft belastbar ist? Wie steht es mit dem „Bauchgefühl“? Und welche Faktoren entscheiden darüber, ob die Partner in ihrer Ehe dauerhaft glücklich bleiben? Sozial- und Verhaltenswissenschaftler haben aktuell erstaunliche Forschungsergebnisse rund um das Thema Ehe und Partnerschaft zusammengetragen.
Dauerhaft glückliche Bindungen werden von den meisten Menschen als erstrebenswert angesehen. Der Beziehungsstatus hat z.B. direkte körperliche Auswirkungen: Verheiratete leben länger, werden seltener krank, ernähren sich gesünder und sind im Alter länger selbständig. Dennoch scheitern viele Paarbeziehungen an Hürden, die für viele nicht vorhersehbar schienen.
In unserer neuen Reihe von Blog-Einträgen werden Studienergebnisse dargestellt, aus denen hervorgeht, dass diese Hürden durchaus voraussehbar sind und – darüber hinaus – dass es möglich ist, in einer Partnerschaft dauerhaft glücklich zu sein.
Der richtige „Riecher“
Bereits in den ersten Augenblicken der Kontaktanbahnung ist unser Unterbewusstsein auf Hochtouren. Beide testen unbewusst ob eine Bindung miteinander wohl haltbar sein könnte: Dafür beiden müssen einander riechen können. Das mag zunächst banal klingen, dennoch haben biopsychologische Studien ergeben, dass der Geruchssinn soziales Verhalten massiv beeinflusst. Er hilft, unbewusst Emotionen in anderen Menschen zu entdecken; Menschen z.B., die ohne Geruchssinn geboren wurden, leiden nachweislich unter erhöhter sozialer Unsicherheit. Aus evolutionärer Sicht ist dieses Auswahlkriterium durchaus sinnvoll, denn ein Geruch, der als attraktiv empfunden wird, deutet darauf hin, dass sich das Immunsystem des Gegenübers vom eigenen unterscheidet, potentielle Nachkommen damit überlebensfähiger sein werden. Wer sich also gerne riechen mag, der bleibt auch länger zusammen.
Aufs Bauchgefühl achten
Bereits kurz nach der Hochzeit spüren die meisten Partner, wie es wirklich um ihre Ehe bestellt ist. Auch wenn sie vom Wunschdenken beseelt sind, eine glückliche und harmonische Ehe zu führen – sich auf das „Bauchgefühl“ zu verlassen, ist sinnvoller, als sich Dinge schönzureden. Konflikte, Missverständnisse oder enttäuschte Erwartungen gehören schon im Keim aufs Tapet: Man muss sie klären, und zwar durch beidseitig wohlwollende 4-Augen-Gespräche. Wobei viele das Feedback-Annehmen zum ersten Mal in ihrem Leben lernen müssen. Sie waren ja vorher noch nie verheiratet und haben das auch nirgendwo gelernt.
Der Psychologe James McNulty führte eine Langzeitstudie an 135 frisch verheirateten Paaren durch. Die StudienteilnehmerInnen wurden vier Jahre lang alle sechs Monate dazu befragt, wie zufrieden sie mit ihrer Ehe waren. Zusätzlich wurde jedes Mal ein sog. Implicit Associations Test durchgeführt, mit dem die unbewusste Einstellung der ProbandInnen zu ihrem/r PartnerIn und ihrer Ehe ermittelt wurde. McNulty’s erstaunliches Ergebnis: Die Paare, die gleich zu Beginn ihrer Ehe negative unbewusste Einstellungen zeigten, hatten im Laufe des Studienzeitraums Eheprobleme und standen vor der Trennung – auch wenn sie sich in der offenen Befragung anfangs geradezu euphorisch zeigten. Das Bauchgefühl lässt sich also nicht überlisten.
Das verflixte vierte Jahr
Der Untersuchungszeitraum von vier Jahren wurde von den Forschern nicht zufällig gewählt. Der sog. Coolidge-Effekt wurde bereits in den 1960-er Jahren entdeckt: Das Level der körpereigenen Glücks- und Bindungshormone Dopamin und Oxytocin – zu Beginn der Partnerschaft auf seinem höchsten Niveau – sinkt im Verlauf der Beziehung stetig und erreicht nach vier Jahren seinen tiefsten Stand. Die sexuelle Anziehungskraft wird damit immer geringer. Etliche Partnerschaften, in denen es die Partner in dieser Zeit nicht geschafft haben, ihre Beziehung auf ein festes Fundament zu stellen, scheitern an dieser Hürde.
Woraus aber besteht ein solches Fundament? Sind Menschen in der Lage, ihrer ganz natürlichen biologischen Entwicklung etwas entgegen zu setzen? Im nächsten Blog-Eintrag wird dieser Frage auf den Grund gegangen.
Quellen:
Croy, I., Bojanowski, V. & Hummel, T. (2013). Men without a sense of smell exhibit a strongly reduced number of sexual relationships, women exhibit reduced partnership security–a reanalysis of previously published data. Biological psychology, 92(2), 292-294.
McNulty, J. K., Olson, M. A., Meltzer, A. L., & Shaffer, M. J. (2013). Though they may be unaware, newlyweds implicitly know whether their marriage will be satisfying. Science, 342(6162), 1119-1120.
Wilson, J. R., Kuehn, R. E., & Beach, F. A. (1963). Modification in the sexual behavior of male rats produced by changing the stimulus female. Journal of comparative and physiological psychology, 56(3), 636.
Wege zum Glück: Dr. Lermer im Interview mit der Apotheken-Umschau
Auch wenn intensive Glücksgefühle eher für den Moment als auf Dauer bestehen – wer mit sich selbst und anderen im Reinen ist, lebt glücklicher
Wenn im Mittelalter der Töpfer Krug und Deckel aus dem Brennofen zog und diese noch immer gut zusammen passten, dann nannte er dieses Gelingen ein „Gelükke“ – ein Glück. Diese Vorstellung vom „Gelingen“ steckt auch heute noch in unserem Glücksempfinden, meint Dr. Stephan Lermer, Psychotherapeut, Coach und Glücksforscher. „Es ist das Gefühl des gelungenen Lebens, das uns in einem glücklichen Moment bewusst wird.“ Das Gefühl, angekommen zu sein, den richtigen Platz im Leben gefunden zu haben – etwas zu tun, in dem wir ganz aufgehen und die Zeit vergessen können.
Diese Empfindung von Glück teilen nach Lermers Einschätzung die meisten Menschen. „Aber die Art und Weise, wie sie zu ihrem Glück kommen, ist doch sehr verschieden.“ Der eine will auf dem Berg alleine sein, der andere braucht Trubel. Der Nächste möchte Teil einer großen Familie sein, ein anderer in trauter Zweisamkeit oder auch mit Gleichgesinnten im Einsatz für eine „große Sache“.
Den eigenen Weg definieren
Deshalb ist für Stephan Lermer die erste Stufe auf dem Weg zum Glück die der Selbsterkenntnis, denn: „Es gibt nicht den einen Weg zum Glück, aber es gibt Ihren Weg zum Glück. Je besser Sie wissen, was Sie wirklich wollen, was Ihnen Freude macht und was Kummer, desto besser können Sie auch danach leben.“ Wer sich beispielsweise mit Freude bewegt oder für eine Idee begeistert, bekommt dadurch einen Schub des „Glückshormons“ Endorphin – „aber nur, wenn sein Tun wirklich seinem inneren Willen entspricht und nicht, wenn er es sich ‚aus Vernunft‘ auferlegt hat.“
Das betont auch der Medizinsoziologe Michael Rosentreter, und rät: „Ergründen Sie für sich, was Ihnen zum guten Leben besonders wichtig ist. Gute Freunde? Die Familie? Eine Arbeit, die vor allem spannend und fordernd, gesellschaftlich sinnvoll, gut bezahlt oder eher einfach und schnell zu erledigen ist? Bildung? Wohlstand?“ Wer weiß, was er will, bekommt es deshalb zwar noch lange nicht gleich. Erst recht nicht, wenn er sich um seine materielle oder gesundheitliche Existenz sorgen muss. „Aber wer sich kennt und frei von existenziellen Nöten ist, kann seinen persönlichen Gestaltungsspielraum – dort, wo er ihn hat – besser nutzen.“
Dankbar sein
Eine weitere wichtige Quelle von Glücksgefühlen sieht Stephan Lermer in der Dankbarkeit. „Indem wir uns bewusst machen: Es hätte auch anders verlaufen, auch weniger gut ausgehen können, schätzen wir mehr, was wir tun und haben und sind glücklich darüber.“ Nicht zuletzt das kirchliche Erntedankfest ist Ausdruck dieser Freude. Religion und Spiritualität helfen im Übrigen vielen Menschen beim Glücklichsein, betont auch Michael Rosentreter. „Sie sehen nicht nur jedes tägliche kleine Glück als Gnade, sondern sehen auch in manch einem Unglück einen tieferen Sinn oder die Chance für etwas Positives.“
Maß halten
Das eigene Glück zu schätzen, dazu gehört Rosentreters Meinung nach auch die Kunst, das richtige Maß zu finden. „Ein Kind freut sich riesig, wenn Sie ihm ein Eis spendieren. Tun Sie dies aber täglich, empfindet es weniger Freude, weil es das Eis für selbstverständlich hält und weniger schätzt.“ Ähnlich verhält es sich mit den Relationen, in denen wir unsere Lebenssituation mit anderen vergleichen: Wer etwa in einer ausreichend großen Wohnung lebt und einer Arbeit nachgeht, die er mag und von der er gut lebt, kann sich wahrhaft glücklich schätzen. Ist derselbe Mensch aber umgeben von Nachbarn in großen Häusern, die von spannenden Jobs und tollen Reisen erzählen, fühlt er sich mit einem Mal weniger glücklich, auch wenn sich objektiv nichts an seiner Lage geändert hat. Auch hier empfiehlt Michael Rosentreter: „Schätzen Sie das Gute, das Ihnen widerfährt, und nehmen Sie sich Zeit, es zu genießen – ohne es daran zu bemessen, was andere tun und haben, und auch ohne davon auszugehen, dass es mehr werden muss.“
Neues denken, lernen, tun
Eingetretene Pfade verlassen, Neues denken, lernen und tun, Abwechslung ins eigene Leben bringen auch das setzt Glücksgefühle frei. Vor allem, wenn Sie dabei erfahren, dass Sie etwas bewirken, dass es auf Sie ankommt, erläutert Lermer. „Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie fragen zwei Arbeiter, die an einer Mondrakete bauen, was sie da machen. Der eine antwortet, er verlegt die Kabel. Der andere macht dasselbe, aber er antwortet strahlend: Wir fliegen auf den Mond! Wer denken Sie ist wohl glücklicher, sowohl bei der Arbeit als auch am Feierabend?“
Auf andere Menschen zugehen
Der Mensch ist ein soziales Wesen. „Mit anderen zusammen zu sein, von ihnen geschätzt zu werden, mit ihnen zu sprechen und zu lachen, das macht uns glücklich“, ist Stephan Lermer überzeugt. Apropos Lachen: „Forscher haben herausgefunden, dass Kinder Tag für Tag 40mal häufiger lachen als Erwachsene. Wir können von den Kindern also noch viel lernen, denn sie nutzen damit eine weitere Glücksquelle, die nichts kostet, aber sehr wirkungsvoll ist.“ Worin sich die Forschung ebenfalls einig ist: Ein effektives Mittel, glücklich zu werden, ist Glück zu verschenken. Denn dabei werden wir selbst glücklicher, resümiert Stephan Lermer. „Das können Sie direkt spüren, wenn jemand vor Ihren Augen Ihr Geschenk auspackt und sich so richtig freut darüber. Da geht Ihnen doch das Herz auf.“
Barbara Erbe / Apotheken Umschau, 22.07.2015
Selbsteinschätzung: Wie gut kennen wir uns selbst?
Wer sich beruflich orientieren will, sollte in der Lage sein, seine Fähigkeiten, Potentiale und Interessen realistisch einschätzen zu können. Auch im Privatleben ist diese Fähigkeit wichtig: Sie hilft, eigene Entwicklungsfelder zu entdecken und sich individuell oder auch gemeinsam als Paar weiterzuentwickeln. Ergebnisse der psychologischen Forschung zeigen jedoch, dass sich viele Menschen mit Selbsterkenntnis schwer tun.
Selbstverständnis und –erkenntnis sind wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Selbstfindung: Nur wer seine Stärken und Schwächen richtig einschätzen kann und seine Interessen kennt, kann es schaffen, langfristig glücklich zu sein – ob im richtigen Beruf, der Partnerschaft oder in der Freizeitgestaltung. Zwei Studien zum Thema Selbstkonzept präsentieren jedoch eher ernüchternde Ergebnisse, denn offensichtlich fällt es vielen Menschen schwer, sich selbst richtig einzuschätzen.
Fehlerhafte Selbsteinschätzung
Die Psychologen Ethan Zell und Zlatan Krizan der Universitäten in North Carolina und Iowa State fassten kürzlich 22 Metaanalysen mit insgesamt mehr als 200.000 StudienteilnehmerInnen zusammen, die die Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzungen eigener Fähigkeiten und objektiven Leistungsmaßen untersuchten. Im Gegensatz zur weitläufigen Meinung konnten sie nur einen mäßigen Zusammenhang finden, denn oft waren die StudienteilnehmerInnen nicht in der Lage, ihre Fähigkeiten in den Bereichen akademische Kompetenz, Intelligenz, Sprachkompetenz, medizinische Kenntnisse, sportliche und berufliche Fähigkeiten korrekt einzuschätzen. Nur wenn nach spezifischen Kenntnissen gefragt wurde und die Leistungstests den ProbandInnen vorher bekannt waren, stimmten Selbsteinschätzung und objektiv gemessene Leistung stärker überein. Wurde dagegen nach Einschätzung der eigenen Fähigkeiten in weiteren Sinn gefragt, lagen die ProbandInnen mit ihrer Einschätzung weit daneben: Sie schätzten sich entweder für sehr viel besser oder sehr viel schlechter ein, als sie tatsächlich waren.
Erkenntnis der fehlerhaften Selbsteinschätzung kann Selbstbewusstein erschüttern
Die Ergebnisse der Studie von Robert Arkin und Jean Guerrettaz der Ohio State University gehen darüber noch hinaus: Sie zeigen, dass die Erkenntnis der eigenen fehlerhaften Einschätzung das Selbstbewusstsein stark erschüttern kann. Für ihre Studie befragten die beiden Psychologen ihre TeilnehmerInnen zunächst, wie sicher sie sich ihrer Selbsteinschätzung seien. Daraufhin teilten sie sie in zwei Gruppen auf: eine Gruppe mit ProbandInnen, die sich sicher waren, sich selbst gut zu kennen und eine mit TeilnehmerInnen, die sich ihrer selbst eher unsicher waren. Im nächsten Test wurden die ProbandInnen gebeten, zehn Charaktermerkmale zu nennen, durch die sich besonders auszeichnen und diese nach Wichtigkeit zu ordnen. Für die als besonders wichtig empfundenen Eigenschaften sollten die StudienteilnehmerInnen im Anschluss konkrete Beispiele aus ihrer Biografie nennen, um sie zu belegen. Besonders diese Aufgabe fiel den meisten der TeilnehmerInnen schwer, auch jenen, die zuvor angaben, sich selbst gut zu kennen. Wurden die ProbandInnen dann mit den Ergebnissen der Tests konfrontiert, zeigte vor allem die Gruppe, die zuvor angegeben hatten, sich gut einschätzen zu können, ein erheblich erschüttertes Selbstbewustsein.
Feedback einfordern
Die genannten Ergebnisse sind sicherlich ernüchternd. Die von Sokrates übermittelte Formel: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, scheint auch auf das Wissen über das eigene Selbst zuzutreffen. Im Gegensatz zur Selbsteinschätzung zeigt die Fremdeinschätzung jedoch sehr oft zutreffendere Ergebnisse. Um sich also seiner Selbst sicherer zu werden, kann es hilfreich sein, sich von anderen einschätzen zu lassen. Ob privat oder beruflich: eine Feedbackkultur, bei der das Gegenüber kontinuierlich und konstruktiv gespiegelt wird, scheint auf dem Weg der Selbsterkenntnis hilfreicher zu sein, als sich auf die eigene und oft fehlerhafte Einschätzung seiner Kenntnisse und Fähigkeiten zu verlassen.
Fazit: Ehrlich Freundschaften pflegen.
Quellen:
Frey, D. (2000). Kommunikations-und Kooperationskultur aus sozialpsychologischer Sicht. In: H. Mandl & G. Reinmann-Rothmeier (Hrsg.) Wissensmanagement. Informationszuwachs-Wissensschwund, (S. 73-92). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
Guerrettaz, J., & Arkin, R. M. (2015). Who Am I? How Asking the Question Changes the Answer. Self and Identity, 14(1), 90-103.
Zell, E., & Krizan, Z. (2014). Do people have insight into their abilities? A metasynthesis. Perspectives on Psychological Science, 9(2), 111-125.
Emotionale Intelligenz: Die Fähigkeit Emotionen zu erkennen beeinflusst das Jahresgehalt
Emotionale Intelligenz, die Fähigkeit, eigene und fremde Emotionen erkennen und sie unterscheiden zu können, ist in den letzten Jahren in den Fokus der psychologischen Forschung gerückt. Es geht darum diese Informationen zu nutzen, um das eigene Denken und Handeln zu lenken. Emotionale Intelligenz gilt als wichtige Schlüsselkompetenz, um im Privatleben, in der Schule und im Beruf erfolgreich sein zu können. Eine neue Studie ermittelte nun sogar einen Zusammenhang mit dem Jahresgehalt.
Wer emotional intelligent ist und so Gefühle, Stimmungen, Leidenschaften und ähnliche emotionale Zustände an sich selbst und anderen richtig erkennt, kann diese Informationen nutzen und damit erfolgreicher im Privat- und Berufsleben sein. Die Ergebnisse einer Studie von Jochen Menges, Professor an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf, gehen noch darüber hinaus: Die Forscher stellten fest, dass sich die Emotionserkennungsfähigkeit auf das Einkommen auswirkt.
Emotionale Intelligenz
John D. Mayer von der University of New Hampshire und Peter Salovey von der Yale University, Begründer der Forschung zu Emotionaler Intelligenz, beschreiben diese als die Fähigkeit, Emotionen an sich selbst und anderen korrekt erkennen und unterscheiden zu können und dies als Informationen nutzen zu können, die das eigene Denken und Handeln lenken. Intelligenz geht also, ihrer Ansicht nach, weit über den klassisch akademischen Intelligenzbegriff hinaus und umfasst nicht nur verbale und numerische Fähigkeiten. Um beruflich und privat erfolgreich sein zu können, reicht es also nicht, in der Schule gute Aufsätze zu schreiben und mathematische Zusammenhänge zu erkennen. Vielmehr seien es Fähigkeiten, die helfen Emotionen zu erkennen und zu beeinflussen, die zu Lebenserfolg nachhaltig beitragen.
Emotionale Intelligenz umfasst somit die Fähigkeit, eigene Emotionen richtig zu erkennen und sie so zu handhaben, dass sie der Situation angemessen sind und helfen, die eigenen Ziele zu erreichen. Empathie, also die Fähigkeit, Emotionen an anderen zu erkennen und mit diesen angemessen umgehen zu können, wird ebenfalls der Emotionalen Intelligenz zugezählt.
Emotionserkennung als ökonomischer Erfolgsfaktor
Mit ihrer Studie konnten Forscher nun die These von Mayer und Salovey bestätigen, denn Emotionserkennung, ein Teilaspekt der Emotionalen Intelligenz, erhöht nicht nur den allgemeinen Lebenserfolg, sondern auch den finanziellen: Sie fanden einen direkten Zusammenhang zwischen der Emotionserkennungsfähigkeit und der Höhe des Jahresgehalts. Mitarbeiter, die Gefühle von anderen besser erkennen konnten, hatten verdienten deutlich besser als ihre Kollegen, die diese Fähigkeit nicht oder nur in geringem Maße aufwiesen. Andere Faktoren wie akademische Intelligenz, Gewissenhaftigkeit, Geschlecht, Alter, Ausbildung, Wochenarbeitszeit und hierarchische Position im Unternehmen wurden in die Untersuchung miteinbezogen, doch auch unter Berücksichtigung dieser Variablen blieb der Zusammenhang zwischen Emotionserkennungsfähigkeit und Jahresgehalt bestehen. Diese Fähigkeit ist also nicht nur von zwischenmenschlicher Bedeutung, sondern hat auch einen deutlichen ökonomischen Wert.
Euphorie – mit Vorsicht
Sicherlich sind diese Ergebnisse erstaunlich und machen deutlich, wie wichtig Emotionale Intelligenz für Lebenserfolg ist. Menschen mit guter Emotionserkennung verhalten sich geschickter in sozialen Kontexten und werden als kooperativer, rücksichtsvoller und hilfreicher eingeschätzt.
Dennoch beinhaltet diese Form der Intelligenz auch die Fähigkeit zur Beeinflussung der Gefühle anderer. Dies kann zum Positiven geschehen, aber auch bedeuten, dass gezielt positive Emotionen geweckt werden, damit Mitarbeiter immer mehr leisten oder Kunden immer bereitwilliger kaufen. Diese Form der manipulativen Beeinflussung, die lediglich einseitig dem Erreichen der Unternehmensziele dient, ist sicher nicht im Sinne der Begründer der Forschung zu Emotionaler Intelligenz.
Emotionale Intelligenz geht weit über die akademische Bildung hinaus. Sie hilft, in sozialen Kontexten erfolgreich zu sein und trägt damit deutlich zum allgemeinen Lebenserfolg bei. Es ist abzusehen, dass ihr dank ihrer Funktion als Wirtschaftsfaktor in Zukunft in der Personalführung und auch in Bildungseinrichtungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden wird.
Quellen:
Goleman, D. (1996). Emotional Intelligence. Why It Can Matter More than IQ. Learning, 24(6), 49-50.
Menges, J., & Ebersbach, L. (2008). Die Bedeutung von Emotionen und emotionalem Kapital im internen und externen Unternehmenskontext. Eine Mentalitätsgeschichte der deutschen Industriegesellschaft am Beispiel des rheinischen Dormagen (1917-1997), Essen, 21-44.
Momm, T., Blickle, G., Liu, Y., Wihler, A., Kholin, M., & Menges, J. I. (2015). It pays to have an eye for emotions: Emotion recognition ability indirectly predicts annual income. Journal of Organizational Behavior, 36(1), 147-163.