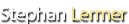Beziehungsqualität entscheidet über den Umgang mit Stress
Eine gute Partnerschaft wirkt sich auch positiv auf berufsbedingten Stress aus. Wenn man es richtig anpackt.
Das schreibt Dr. Ann-Christin Andersson Arntén in ihrer Dissertation an der University of Hawaii (stressfreie Zone). Sie erhob bei 900 Paaren die Wechselwirkungen von Partnerschaftsqualität und arbeitsbedingtem Stress.
Ein auffälliges Ergebnis ihrer wissenschaftlichen Studien ist, dass die individuellen Unterschiede im Stresserleben, bei der Stressverarbeitung und im Umgang mit Stress und der Partnerschaft größer waren als die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Dies zeigt, wie wichtig die Interpretation von Stress, der individuelle Umgang mit Stressoren und Strategien zur Prävention von Stress sind. Vor allem körperliche Auswirkungen von Stress und schlechter Beziehungsqualität zeigen sich bei Männern und Frauen gleichermaßen.
Zwischen den Geschlechtern gibt es vor allem Unterschiede im Stresserleben (wir berichten im Beitrag vom 30.6.09). Zudem zeigte sich, dass Frauen, die über Beziehungsprobleme klagten, mehr Angstsymptome, mentale Stressreaktionen und Schlafprobleme hatten. Männer, die über eine mittlere Beziehungsqualität berichteten, litten mit größerer Wahrscheinlichkeit an Depressionen, Angstzuständen und psychosomatischen Beschwerden.
Warum ist die Beziehungsqualität ein so entscheidender Moderator für berufsbedingten Stress? Andersson Arnténs Forschung unterstützt ein ‚Ressourcenmodell‘ der Stressverarbeitung: Solange wir Druck ausgesetzt sind, versuchen sich Körper und Geist darauf einzustellen, damit fertig zu werden, den Stress auszuhalten, um Probleme und Herausforderungen bewältigen zu können. Wird der Stress irgendwann zuviel oder chronisch, ermüden sowohl Körper als auch Geist: Wir fühlen uns müde, erschöpft, unausgeglichen, angespannt, die Gedanken kreisen immer wieder um die stressauslösenden Themen usw. Kurz: Unsere körperlichen und mentalen Ressourcen sind aufgebraucht.
Um dem Stress die Stirn bieten zu können und unsere Herausforderungen bewältigen zu können, müssen wir unsere Ressourcen wieder herstellen, wir müssen „den Akku wieder aufladen“.
Andersson Arntén: „Eine positive Sicht der Dinge und Techniken zum Stressmanagement helfen, die negativen Effekte von berufsbedingtem Stress zu mildern. Aber wenn es sowohl in der Arbeit als auch in der Partnerschaft Stress gibt, steigt das Risiko für Burnout und psychosomatische Krankheiten dramatisch an.“
Allzu oft übertrage man Konflikte und Zeitdruck am Arbeitsplatz in die Partnerschaft. Dabei übersehe man, dass die Partnerschaft die größte Ressource für den Umgang mit berufsbedingtem Stress sein kann.
Wenn man also nachhaltig und ressourcenorientiert mit Stress umgehen will, sollte man 1. vermeiden, arbeitsbedingten Stress in die Beziehung zu übertragen und 2. die Partnerschaft aktiv stärken, denn: In einer vertrauensvollen Partnerschaft werden die Akkus am schnellsten wieder geladen.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Andersson Arntén, AC (2009). Partnership relation quality modulates the effects of work-stress on health. Doctoral Dissertation, John A. Burns School od Medicine, University of Hawaii
Bore-Out-Syndrom – Krank vor lauter Langeweile
in Kooperation mit news.de
 Zu viel Stress macht krank und kann zum Burnout-Syndrom führen. Doch auch zu wenig Anforderung und Langeweile im Job können das seelische Gleichgewicht ins Wanken bringen. Die Fachwelt spricht dann vom Bore-Out-Syndrom.
Zu viel Stress macht krank und kann zum Burnout-Syndrom führen. Doch auch zu wenig Anforderung und Langeweile im Job können das seelische Gleichgewicht ins Wanken bringen. Die Fachwelt spricht dann vom Bore-Out-Syndrom.
Das Bore-Out-Syndrom ist als Gegenstück zum Burnout-Syndrom zu verstehen. Die Symptome sind sich sehr ähnlich. Der Name leitet sich ab vom englischen Begriff «to bore», was so viel bedeutet wie «langweilen».
Der Mensch braucht ein angemessenes Maß an Abwechslung, Reizen und Herausforderungen, eben ein gesundes Maß an Stress, erklärt der Münchner Psychologe und Coach Dr. Stephan Lermer. Bekommt er zu viel davon oder zu wenig, dann kann dies zu Depressionen und anderen psychosomatischen Symptomen führen. So sei erwiesen, dass nach einem Passivurlaub, den man drei Wochen lang faulenzend am Pool verbringt, der Intelligenzquotient um 20 Punkte abfällt.
Arbeitnehmer, die an Bore-Out-Syndrom erkranken, fühlen sich durch Unterforderung gestresst.
Sie werden häufig als faul betrachtet, doch das ist nicht der Fall, betont Lermer. «Der will ja arbeiten», sagt der Glücksforscher, «bekommt aber nicht genügend herausfordernde Aufgaben.»
Freut sich der Betroffene im Büro anfangs noch über die wenige Arbeit und darüber, ungestraft im Internet surfen und anschließend in Ruhe Zeitung lesen zu können, wird ihm bald langweilig. «Doch kaum jemand gibt gerne zu, sich bei der Arbeit zu langweilen und im Umkehrschluss nicht gebraucht und somit nutzlos zu sein», sagt Lermer. Deshalb versuchen die Betroffenen anfangs, ihre fehlende Arbeit zu kaschieren. Etwa durch geschäftiges Tippen auf der Tastatur, sobald ein Kollege in der Nähe ist. Oder durch Verzögern der Aufgaben, die man längst hätte fertig haben können.
«Doch irgendwann kippt das um», sagt Lermer. Und zwar in Desinteresse. «Der Betroffene sieht sich dann als Opfer.» Etwa durch Fehler des Vorgesetzten oder der Geschäftsleitung. «Er merkt, dass ihm eine ganz wichtige Quelle an Anerkennung fehlt», erklärt Lermer den Mechanismus, der sich schnell zu einem Teufelskreis entwickelt.
Frauen finden schneller aus dem Teufelskreis
Dennoch werden die wenigsten Bore-Out-Betroffenen von sich aus aktiv und bitten ihre Vorgesetzten um neue oder herausfordernde Aufgaben. Grund dafür sei zum einen, dass in Deutschland Arbeit negativ besetzt ist und immer noch mit lästiger Maloche gleichgesetzt wird, ist Lermer überzeugt. Andererseits scheuen sich viele vor der Verantwortung, die eine größere Aufgabe mit sich bringen könnte. «Wer unterfordert ist, der kann auch nichts falsch machen und anschließend nicht schuld seien, wenn etwas schief läuft», so Lermer.
Hilfe und ein Erkennen der Problemursachen kommen meist erst von außen. Etwa von einem Hausarzt oder Psychologen, der wegen einer bereits vorhanden Depression aufgesucht wird. Oder von der Lebenspartnerin, die sich mit der Situation ihres Mannes auseinander setzt. Überhaupt sei das Bore-Out-Syndrom hauptsächlich ein Männerproblem. Frauen würden zumindest schneller wieder aus dem Teufelskreis herausfinden, vermutet Lermer. Grund: Sie kommunizieren ihre Probleme tendenziell viel stärker. «Aber Männer, die an Burnout leiden, erkennen dies ja auch nicht als Krankheit, sondern sehen darin, wie auch im Bore-Out, ein eigenes Versagen», gibt Lermer zu bedenken.
Ist die Ursache erkannt, lässt sich gegen die äußeren Umstände angehen, etwa durch ein Gespräch mit dem Vorgesetzten, dem Betriebsrat oder einer Vertrauensperson im Büro. Kehrt wieder Anerkennung durch gemeisterte Herausforderungen in den Berufsalltag ein, verbessert sich auch die Symptomatik. «Wir sind auf Herausforderung angelegt», so Lermer. «Bequemlichkeit ist kein Weg zum Glück.»
Text: news.de-Redakteurin Katharina Peter
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Die größten Stress-Nester
Passend zum gestrigen Thema Burnout heute eine aktuelle Studie des Forsa-Instituts. Die Demographen fragten über tausend Deutsche, bei welchen Gelegenheiten sie am häufigsten Stress empfinden. Das Ergebnis bestätigt die aktuelle Stressforschung, bedarf allerdings einiger kritischer Kommentare:
 Der mit Abstand größte Stress-Faktor bleibt also der Job. Völlig verständlich, denn unsere ‚althergebrachten‘ evolutionären Stressverarbeitungsstrategien passen einfach nicht zu den ständig zunehmenden Anforderungen unserer Dienstleistungsgesellschaft. Es ist deshalb die Aufgabe jedes Einzelnen, stresskompetent zu werden für die täglichen Stressoren im Beruf.
Der mit Abstand größte Stress-Faktor bleibt also der Job. Völlig verständlich, denn unsere ‚althergebrachten‘ evolutionären Stressverarbeitungsstrategien passen einfach nicht zu den ständig zunehmenden Anforderungen unserer Dienstleistungsgesellschaft. Es ist deshalb die Aufgabe jedes Einzelnen, stresskompetent zu werden für die täglichen Stressoren im Beruf.
A propos tägliche Stressoren: Hausarbeit und ‚Fahrten zur Hauptverkehrszeit‘ gehören ganz klar in diese Kategorie. Gerade hier kann man mit Entspannungstechniken und vor allem einem effizienteren Zeitmanagement viel verändern. Dabei gilt es vor allem, sich von unnützem ‚Ballast‘ zu befreien: Muss man jeden Tag zur Arbeit fahren oder kann man teilweise auf Teleworking umsteigen? Sollte man sich eventuell einen Job mit flexibleren Arbeitszeiten suchen, der mehr Chancen bietet, die freie Zeit zu gestalten? Und die Wohnung mal wieder gründlich entrümpeln?
Finanzielle Sorgen und die Pflege von Angehörigen sind ernsthafte Stressoren, die sich nicht einfach bagatellisieren oder abschieben lassen. Also bitte keine Scheu, Hilfe von Dritten anzunehmen, die Verantwortung zu teilen und die belastenden Probleme mit nahe stehenden Personen zu besprechen! Kindererziehung dagegen wird in seiner Stress-Rolle häufig überschätzt. Denn obwohl gehänselte Kindergartenkinder oder sich prügelnde Teenager, die gelegentlich ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, akute und schwer wiegende Stressoren sein können – Kinder und deren Erziehung wirken in den meisten Fällen und auf lange Sicht protektiv. Das bedeutet, dass Kindererziehung, genau wie eine feste Partnerschaft, langfristig das Stressniveau senkt und das Lebensglück erhöht.
Zuletzt zu den Konflikten: Sicher gibt es ernste Konflikte, die kommunikativ aufgelöst werden müssen. Aber oft genug regen wir uns über Banalitäten auf. Es gilt deshalb zu allererst, diese banalen Streitverursacher zu identifizieren. Fragen Sie sich einmal eine Zeit lang nach jedem Streit – im Job oder privat – ob der Ausgang des Konflikts entscheidend für Ihr weiteres Leben war. Für manche Konflikte mag das zutreffen, für die meisten nicht. Seien Sie in diesen Situationen einfach beim nächsten Mal diplomatischer und versuchen Sie immer ziemlich zeitnah und rasch, einen Kompromiss zu finden, der beide Seiten zufrieden stellt.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Psychologische Begriffe: ‚Burnout‘
Burnout ist ein Warnsignal an Ihren Körper und Ihre Vernunft. Es sagt Ihnen unmissverständlich: Ändern Sie etwas an Ihrer Lebensführung. Ändern Sie sie jetzt. Oder: Gehen Sie vor die Hunde.
Die Liste der Burnout-Symptome liest sich wie ein Who-is-Who der Anzeichen für eine manifeste Depression: mangelndes Interesse an beruflichen Aufgaben, Lustlosigkeit, Gereiztheit, Versagensängste, Abgeschlagensein, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Stimmungsschwankungen und körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen und Verdauungsstörungen.
Erstes für alle sichtbares Symptom ist die soziale Isolation: Rückzug von Kollegen, Freunden und Familie, weil eben ‚alles zuviel wird‘. Und man sich lieber in die Einsamkeit flüchtet oder in übermäßigen Gebrauch von Genussmitteln. Beides Eigentore. Denn gerade im Anfangsstadium des Ausgebranntseins sollte man die wenigen züngelnden Flammen nutzen, um bei anderen Menschen Feuer zu entfachen: Ehrliche, schonungslose Gespräche mit Bekannten, der Aufbau gesundheitsförderlicher Präventionsprogramme und Aktivitäten mit Freunden und Familie. Kurz: Alle Arten sozialer Unterstützung helfen, das Feuer zu schüren.
Das Gefährliche: Immer wieder werden Burnout-Symptome absichtlich ‚übersehen‘, weil man sich nicht damit abfindet, zu den Leuten zu gehören, bei denen ‚der Akku leer ist‘. Diese Einstellung ist grundlegend falsch. Akkus müssen von Zeit zu Zeit aufgeladen werden. Bei allen Menschen.
Denn Burnout-Symptome sind nichts anderes als langzeitige Folgen eines Phänomens, das nun wirklich jeder erlebt: Stress. Und obwohl unser Stressempfinden zum Großteil von unserer psychischen Bewertung abhängt, entfaltet der Stress seine zerstörerische Wirkung vor allem körperlich. Hauptbestandteil der schädlichen Stressreaktion ist das Hormon Cortisol, das Blutdruck und Blutzucker erhöht, Muskelgewebe zerstört, Fetteinlagerung begünstigt und die Bildung freier Radikale fördert, die wiederum den Alterungsprozess beschleunigen.
Was können Sie tun, um Stress und Burnout gegenzusteuern? Zunächst einmal: Stellen Sie ganz nüchtern und ohne ‚Passiert-„mir“-doch-nicht-Attitüde‘ fest, ob Sie gefährdet sind. Dazu genügen oft schon kleine Checklisten, wie diese beiden (bitte Bildausschnitt anklicken, um die Tests zu bearbeiten):
Würden Sie dort tatsächlich feststellen, dass Sie gefährdet sind, sollten Sie handeln.
Und zwar nicht erst morgen. Beginnen Sie jetzt.
Die besten Techniken gegen Stress und Burnout haben keine Nebenwirkungen:
Sprechen Sie sich bei einem nahe stehenden Menschen aus. Bitten Sie ihn um seine Einschätzung.
Suchen Sie falls notwendig kurzzeitig (!) professionelle Hilfe auf, um eine Einstellungsänderung hin zu einem neuen Selbstverständnis und einem glücklicheren, erfüllteren Leben in Gang zu setzen.
Machen Sie Sport. Bewegung ist DER Killer für alle körpereigenen Substanzen, die zu den typischen Burnout-Symptomen führen. Übertreiben sollten Sie es allerdings nicht: Auch Extremsport fördert die Bildung von Stresshormonen. Moderater Sport, etwa 3 mal wöchentlich 1 Stunde Bewegung kann Wunder bewirken. Das ist keine Floskel.
Suchen Sie bewusst Entspannung. Jeder Mensch entwickelt seine eigene Entspannungstechnik. Was liegt Ihnen? Yoga, bewusstes Nichtstun und Nichtsdenken, Qui-Gong, Autogenes Training, Musik hören und sich darin verlieren, Musik spielen, Meditation, Beten, Progressive Muskelrelaxation und Biofeedback sind die am besten wissenschaftlich abgesicherten Entspannungsformen. Was liegt Ihnen?
Wichtig bei alldem ist zu begreifen, dass Burnout kein Zeichen von persönlicher Schwäche ist. Es ist eine medizinisch begründbare Krankheit. Ihre Ursache: Unsere evolutionär bedingten Stressreaktionen, die nicht zum ständigen Stress unserer westlichen Leistungsgesellschaft passen. Ziel einer jeden Burnout-Therapie ist es daher, seine persönlichen Stressoren zu erkennen und sie aufzulösen. Start: heute.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
‚Gender matters‘: Unterschiedlicher Umgang von Frauen und Männern mit Stress zeigt sich im Gehirn
Forscher der University of Pennsylvania weisen mit neurophysiologischen Methoden nach, dass Frauen und Männer unterschiedlich auf Stress reagieren. Dies hat Folgen für die Behandlung von stressbedingten Erkrankungen wie Burnout, posttraumatische Stressbelastung und Depression.
Männer stammen vom Mars, Frauen von der Venus. Das ist wohl die einfachste Erklärung für die offensichtlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Einen wesentlich differenzierteren Einblick in die unterschiedlichen Erlebniswelten von weiblichen und männlichen Menschen von heute liefern moderne bildgebende Verfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT). Mit deren Hilfe kann belegt werden, dass Männer und Frauen wirklich teilweise sehr unterschiedlich reagieren.
Zum Beispiel unter Stress: Forscher der University of Pennsylvania überwachten mittels fMRT den Blutfluss im Gehirn ihrer Probanden, während sie sie künstlich Stress aussetzten. Die Teilnehmer wurden angewiesen, von 1600 in 13er-Schritten rückwärts zu zählen. Dabei reagierte der Versuchsleiter ärgerlich auf Fehler und wies sie ständig an, schneller zu zählen (siehe dieses Video).

Beim fMRT können Änderungen des Blutflusses in sämtlichen Hirnregionen mit relativ guter räumlicher Auflösung erfasst werden. Was bringt das? Einfach gesagt: Braucht eine bestimmte Hirnregion Blut, dann arbeitet sie. Zum Denken brauchen wir nämlich Nährstoffe, vor allem Sauerstoff und Zucker. Unser Gehirn ist für 90% des Sauerstoffverbrauches verantwortlich.
Das Ergebnis der Untersuchung: Männer wie Frauen berichteten, sie wären während des Zählens gestresst gewesen. Und zumindest äußerlich zeigten Sie auch dieselben Symptome (Sprache, Atmung, Herzratenanstieg, Cortisolanstieg). Allerdings wurden bei Männern und Frauen zum Teil andere Gehirnareale aktiv:
Bei Männern reagierte der rechte präfrontale Cortex stärker. Er ist Teil des sogenannten ‚Fight-or-Flight‘-Systems, das in Stresssituationen Verhaltensreflexe auslöst. Sprich: Entweder Kampf oder Flucht. Im Alltag werden diese automatischen Reflexe normaler Weise durch geselschaftliche Normen gehemmt. Im fMRT dadurch, dass man fixiert ist.
Bei Frauen dagegen war das limbische System aktiver – ein Verbund von Hirnregionen, die für das Aufkommen und die Verarbeitung von Emotionen eine wichtige Rolle spielt. Es zeigt sich also schon im Gehirn, dass Männer unter Stress eher aggressiv und fahrig reagieren, Frauen dagegen emotionaler. Deshalb kommen sie aber nicht automatisch von anderen Planeten.
Die unterschiedlichen Stressverarbeitungsstrategien sind zum Teil genetisch bedingt, zum Teil aber auch in Kindheit und Jugend gelernt.
Wir verfolgen diesen vielversprechenden neuen Forschungszweig mit großer Spannung. Durch die Aufdeckung neurophysiologischer Unterschiede bei der Stressverarbeitung in den Gehirnen von Männern und Frauen werden sich weitere interessante Strategien für den Umgang mit psychischen Belastungen ergeben.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Wang, J. (2007). Gender difference in neural response to psychological stress. Social cognitive an affective neuroscience, 2007, 2(3), pp. 227-239
Stress löst Gehirnstrukturen auf
Wie gravierend sich Stress auf das Gehirn auswirkt, zeigte eine Studie der Yale School of Medicine im März dieses Jahres:
Unter langandauerndem Stress zeigen wir oft hilfloses Verhalten, Resignation macht sich breit. Dieses Verhalten ist nicht nur Nährboden für psychische Beeinträchtigungen wie Depression, Burnout oder Agoraphobie. Es spiegelt sich auch im Zerfall von Synapsen (Verbindungen zwischen Nervenzellen im Gehirn) im Hippocampus wider – einer Hirnstruktur, die für Erinnern und emotionale Verarbeitung mitverantwortlich ist.
„Der Synapsenverlust ist wahrscheinlich die Ursache für die rapide Verschlechterung der Stimmung bei depressiven Patienten“ behauptet Tibor Hajszan aus der Forschergruppe der Yale School of Medicine. Zusammen mit seinen Kollegen sucht er nach Medikamenten, die diese Synapsen kurzfristig wieder aufbauen, um eine Behandlung von Depression und Burnout zu ermöglichen.
Für langfristigen Aufbau und Erhalt von Synapsen ist vor allem Aktivität förderlich. Psychotherapeuten tragen dem in vielen Behandlungsansätzen Rechnung, beispielsweise in der Verhaltenstherapie. Aber auch präventiv kann eine Menge getan werden, um Resignation, hilfloses Verhalten und damit assoziierte organische Gehirnveränderungen zu vermeiden:
Bewegung,
gesunde Ernährung und vor allem
sinnvolle Aktivitäten
sind interessanter Weise also auch wichtige Grundlagen auch psychischer Gesundheit.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Hajszan, T. et al. (2009). Remodeling of Hippocampal Spine Synapses in the Rat Learned Helplessness Model of Depression. Biological Psychiatry, 65 (5), 392-400