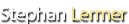Wissenschaft: Vom Glauben und Berge versetzen…
„Nix is umsonst und sogar da Tod kosts‘ Leben“ – dies besagt ein altes bayrisches Sprichwort und gerade in der Arbeitswelt kennen wir sie alle: Mitarbeiter die um Punkt 17 Uhr den Bleistift fallen lassen. Im eigenen Projekt wird lieber auf Zeitlupenmodus geschaltet, anstatt dem überlasteten Kollegen unter die Arme zu greifen. Am Chef und der Firma wird kein gutes Haar gelassen. Konstruktive Verbesserungsvorschläge hört man kaum.
Doch es geht auch anders: Wie kommt es, dass manche durchaus bereit sind sich über den „Dienst nach Vorschrift“ hinaus für den Betrieb ein zu setzen? Ob Einarbeiten eines neuen Kollegen, freiwillige Weiterbildung, um neue Erkenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, oder aber der selbstgebackener Kuchen für die Belegschaft – „Freiwilligen Arbeitsengagement“ hat viele Gesichter. Dass es auch tatsächlich dazu kommt hängt vor allem mit der Arbeitsatmosphäre und dem organisatorischen Partizipationsgrad zusammen. Darüber hinaus spielt ein anderer Faktor eine herausragende Rolle: der Glaube an sich selbst.
Sozialpsychologen der Ruhr-Universität Bochum untersuchten eine Stichprobe von 126 Personen verschiedener Branchen und Positionen (10% Führungskräfte, 72% Mitarbeiter, 7% Selbstständige, 11% Auszubildende). Das Ziel der Studie bestand darin die wichtigsten Motivationsfaktoren zu identifizieren, welche Mitarbeiter dazu bewegen sich freiwillig zu engagieren. Dabei überprüften die Autoren das Modell von Parker et al. (2006), das vier Faktoren postuliert, die Einfluss auf das freiwillige Engagement haben:
1. Selbstwirksamkeit: „Ich kann diese Aufgabe bewältigen“
2. Kontrolleinschätzung: „Ich habe Kontrolle über den Aufgabenprozess und kann positiv auf das Ergebnis einwirken“
3. Veränderungsorientierung: „Ich fühle mich verpflichtet, konstruktiv an Veränderungsprozessen mit zu wirken“
4. Flexible Rollenorientierung: „Diese Aufgabe fällt in meinen Verantwortungsradius, ich fühle mich für die Lösung des Problems verantwortlich“
Es konnte empirisch gezeigt werden, dass der Glaube an sich Selbst, die Überzeugung einer Aufgabe gewachsen zu sein, in starkem Zusammenhang steht mit dem freiwilligen Arbeitsaufwand zu Gunsten der Organisation. Die anderen drei Faktoren, Kontrolleinschätzung, Veränderungsorientierung und flexible Rollenorientierung, belegten lediglich eine untergeordnete Rolle. Die Selbstwirksamkeit ist es, sie wirkt demnach als eine Art „Mediator“ zwischen Eigenverantwortlichkeit als Disposition und dem konkret gezeigten, freiwilligen Engagement (intentional, situationsangemessen, selbstgesteuert).
Welche Auswirkungen hat dieses eigenverantwortliche Arbeitsengagement noch? Nach Bierhoff und Kollegen (2012) verbessert sie die qualitative, sowie die quantitative Arbeitsleistung direkt. Auch die Kundenzufriedenheit erhöht sich nachweislich, weil der Mitarbeiter durch eigenverantwortliches Handeln flexibler auf die Wünsche des Kunden eingeht . Auch die freiwilligen Helfer selbst profitieren: durch das proaktive, freiwillige Verhalten wird auch Ihr eigenes Wohlbefinden erhöht (Brown, et al. 2009) – überdies die Identifikation mit dem Unternehmen und der eigenen Arbeit.
WinWin: Als Führungskraft an der Selbstwirksamkeitserwartung der Mitarbeiter an zu setzen, ist demnach für alle Seiten lohnenswert. Diese lässt sich am effektivsten steigern durch eine gezielte Verhaltensänderung: Wenn der Chef einem Mitarbeiter Aufgaben zutraut, die bislang nicht in seinem Aufgabenhorizont lagen und er dabei positive Ergebnisse erzielt, wird dieser Mitarbeiter bei der nächsten Aufgabe stärker an seine Fähigkeit glauben und vermutlich „mehr“ geben. Durch die erhöhte Selbstwirksamkeit und das „Anpacken von Problemen in Eigenregie“, können Erfolgserlebnisse geschaffen werden, die das von allen ersehnte Gefühl von „Yes – We can“ erzeugen. Diese Erfolgserlebnisse wirken wiederum als positiver Anreizwert zur Ausbildung und Aufrechterhaltung weiteren freiwilligen Arbeitsengagements.
Ein Engelskreis ist geboren. Worauf warten Sie noch? Fangen wir an.
Quellen:
Bierhoff, W., Lemiech, K. & Rohmann, E. (2012). Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit und freiwilliges Arbeitsengagement. Wirtschaftspsychologie, 1, 83-90.
Brown, S., Smith, D. & Schulz, R., et al. (2009). Caregiving behavior is associated with decreased mortality risk. Psychological Science, 20, 488-494.
Parker, S., Williams, H., & Turner, N. (2006). Modeling the antecedents of proactive behavior at work. Journal of Applied Psychology, 91, 636-652.
Kausalattribution – Glück und Unglück durch Ursachenzuschreibung
Warum schaffen es manche Menschen, nachhaltig von Erfolgen zu zehren, während bei anderen das Glück immer nur von kurzer Dauer ist? Wieso geht für manche bereits bei kleinen persönlichen Misserfolgen die Welt unter, während manche die berühmten „twists and turns“ im Leben lässig mit einem Schulterzucken abtun? Warum machen es sich manche Leute so unglaublich schwer, obwohl doch ihr Leben größtenteils von Glück bestimmt ist?
Die Herren Rotter, Seligman und Weiner helfen uns bei diesen Fragen weiter. Sie gehörten verschiedenen Forschergruppen an, die sich ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem Phänomen der „Kausalattribution“ (deutsch: Ursachenzuschreibung) beschäftigten. Damit gingen sie zwei wichtigen Frage nach: 1. Wen oder was kann man für Erfolg und Misserfolg verantwortlich machen? und 2. Macht es einen Unterschied, wen oder was wir verantwortlich machen?
Zur Beantwortung der Fragen benutzen wir Otto Normalverkäufer. Herr Normalverkäufer hat gerade erfahren, dass er im letzten Quartal die höchste Abschlussquote aller 17 Verkäufer erreicht hat und eine satte Prämie kassiert. Er kann nun Stolz empfinden und sich selbst sagen, dass er ja immer wusste, dass er der beste Verkäufer sei. Oder er kann Schuld empfinden und die hohe Abschlussquote auf strukturelle Bedingungen in seiner Region zurückführen – zum Beispiel die Öffnung eines Neubaugebietes und damit den Zuzug vieler potentieller Neukunden, die seine Arbeit „erleichtert“ haben.
Herr Normalverbraucher kann also entweder „internal“ attribuieren („ich bin eben der beste“) oder „external“ („die Bedingungen waren eben gut“). Rotter, Seligman und Weiner würden ihm zur internalen Attribution raten: Bei Erfolgen führt eine internale Ursachenzuschreibung zu langfristiger Zufriedenheit. Bei Misserfolgen ist es genau anders herum: internale Zuschreibung führt dazu, dass wir längerfristig schlecht von uns denken – definitiv ein „Glückskiller“. Externale Zuschreibung dagegen lässt uns die schlimmen Dinge leichter nehmen – „es war halt Pech, beim nächsten Mal wird es wieder besser“.
Es macht also sehr wohl einen Unterschied, wen oder was wir für unsere (Miss-)Erfolge verantwortlich machen. Interessant dabei: Dieser Urteilsbildungsprozess läuft zunächst unbewusst ab. Herr Normalverkäufer bekommt also auf Grund der unbewussten Urteilsbildung erst einmal ein gutes oder schlechtes Gefühl. Dieses Gefühl motiviert ihn, anschließend Erklärungen für seine Stimmung zu suchen. Kennt man nun dieses Prinzip, kann man die eigene Stimmung mit einiger Übung zum Teil nachträglich und nachhaltig beeinflussen.
Das heißt nicht, dass man zum „Berufsoptimisten“ werden soll oder zur Nervensäge, die noch am Weltuntergang irgendetwas Schönes findet. Aber es hilft oft, dem Schlechten den Schrecken zu nehmen und Selbstwertgefühl aufzubauen. „Jeder ist seines Glückes Schmied“ – für wenige Dinge gilt dieses Sprichwort so sehr wie für die Kausalattribution von persönlichen Erfolgen und Misserfolgen.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Anderen die Schuld zuschieben… ist ansteckend!
Anderen die Schuld für eigene Versäumnisse zuzuschieben, ist einfach, aber langfristig schädlich. Zudem ist dieses Verhalten ansteckender als die Schweinegrippe und kann das Organisationsklima innerhalb kürzester Zeit nachhaltig verschlechtern.
„Schuldzuweisungen erschaffen eine Kultur der Angst“ sagt Prof. Dr. Nathanael Fast, Psychologe an der University of Southern California in Los Angeles. In einigen Experimenten untersuchte er Dynamik und Auswirkungen von öffentlichen Schuldzuweisungen und öffentlicher (unberechtigter) Kritik. Er stellte dabei fest, dass Menschen sich schneller von schlechten Beispielen anstecken lassen, als sie selbst zugeben würden:
„Wenn wir beobachten, wie andere ihr Ego schützen, indem sie andere angreifen und ihnen die Schuld für Fehler zuschieben, beginnen wir rasch selbst damit, solche Verteidigungsstrategien zu entwickeln. Wenn wir dann unser Selbstbild schützen, indem wir anderen die Schuld geben, fühlt sich das in dem Moment gut an.“ Langfristig nähme das Ego jedoch Schaden, meint Fast. Genau wie die eigene Reputation, die Arbeitszufriedenheit und die Leistung ganzer Arbeitsgruppen und Organisationen.
Was aber tun, wenn man sein Ego bedroht sieht und die Schuld gerechterweise auf andere Schultern verteilen will?
Zunächst rät Fast zur alten Weisheit, die Schuldfrage erst einmal unter vier Augen zu klären – damit kein Außenstehender sich das Verhalten von Schuldzuweisungen und Aggression ‚abschauen‘ kann: „Loben Sie in aller Öffentlichkeit, kritisieren Sie unter vier Augen.“ Oder etablieren Sie eine Kultur, in der Fehler nicht nur toleriert, sondern als Chance zu Verbesserung und persönlicher Entwicklung wahrgenommen werden.
Fast zeigt in seinen Experimenten auch, dass ein hohes Selbstwertgefühl vor Schuldzuweisungen schützt: Versuchsteilnehmer, deren Selbstvertrauen durch ein kurzes Training gestärkt worden war, zeigten sich weitaus weniger anfällig für Schuldzuweisungen und sorgten in der Regel für ein positiveres Klima und produktivere Arbeitsbedingungen in ihrem Umfeld.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: www.eurekalert.org/pub_releases/2009-11/uosc-sbi111909.php
Psychologische Begriffe: „Intrinsische Motivation“
Wenn ich mich abends ans Klavier setze, um etwas zu komponieren kann es sein, dass ich die Zeit vergesse. Obwohl man das Komponieren als Arbeit bezeichnen könnte, deren Ergebnisse dazu dienen anderen Leuten Spaß zu machen, fühlt es sich so an, als würde allein das Spielen, Improvisieren, Aufnehmen und Aufschreiben der Noten den Lohn der Arbeit darstellen. Ich fühle mich gut.
Wenn ich morgens routinemäßig die Emails checke und beginne, sie zu beantworten, kann es sein, dass ich einen gewissen Widerwillen gegen diese Aufgabe spüre. Ich muss mich dann zwingen, die immer gleichen Formulierungen zu bemühen oder ad hoc Lösungen für brennende Probleme zu suchen oder Termine abzustimmen. Obwohl ich anerkenne, dass die Tätigkeit für mich und für andere wichtig ist, muss ich mir die Ergebnisse und positiven Folgen meiner Schreiberei vor Augen führen, damit ich wirklich „dran bleibe“. Wo es möglich ist, bemühe ich das Telefon, weil diese Art der Kommunikation wesentlich effizienter ist. Ich fühle mich etwas „genervt“.
Vielleicht ist es bei Ihnen gerade anders herum, vielleicht liegt ihnen keine der Alternativen oder sie „mögen“ beide. Entscheidend ist, dass wir alle Tätigkeiten kennen, die uns um ihrer selbst Willen Spaß machen. Und auf der anderen Seite Tätigkeiten, zu denen wir uns zwingen müssen, weil wir spüren, dass sie wichtig sind und ihre Ergebnisse entscheidend sein könnten – für uns oder für andere.
Psychologen sprechen im ersten Fall von „intrinsischer Motivation“: Tätigkeiten, die uns intrinsisch motivieren, sind sozusagen Selbstzweck. Wir würden sie aus purer Freude ausführen, selbst wenn wir nichts dafür bekämen. Tennis oder Fußballspielen, Klatsch und Tratsch austauschen, sich (zeitweise) mit Kindern beschäftigen oder Singen gehören für viele Menschen dazu. Kurz: Intrinsische Motivation kommt aus der Tätigkeit selbst.
Dagegen kommt „extrinsische Motivation“ aus Quellen, die außerhalb der Tätigkeit und uns selbst liegen. Routineaufgaben und Hausarbeit gehören dazu, aber auch zum Beispiel viele Aktivitäten, die wir unternehmen, wenn wir eine Diät machen oder unsere Kinder ausbilden oder generell Probleme in Beruf und Privatleben lösen.
Im Allgemeinen empfehlen Psychologen, sich wo möglich intrinsisch motivierende Tätigkeiten zu suchen und diese auszuleben. Wie kommt man zu diesen Tätigkeiten? Die einfachste und zugleich wirksamste Strategie ist, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihnen eine (Berufs-)Tätigkeit wirklich Spaß macht, probieren Sie es aus oder stellen Sie sich diese Tätigkeit mit allen Sinnen und sämtlichen zugehörigen Situationen vor. Was fühlen Sie? Ein angenehmes Kribbeln und den Wunsch, loszulegen oder ein unangenehmes Ziehen und die Tendenz, von der Idee Abstand zu nehmen?
Für Eltern, Führungskräfte und Coaches ist es in der Regel entscheidend zu wissen, was Ihre Kinder/Mitarbeiter/Klienten intrinsisch motiviert. Denn ein Ergebnis zieht sich wie ein roter Faden durch die Motivationsforschung: Intrinsisch motivierte Personen sind nicht nur zufriedener, sondern auch durchweg erfolgreicher in dem, was sie tun.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Wie sich Wahlverlierer motivieren können
Frank Walter Steinmeier hat es sicher nicht leicht in diesen Tagen. Ohne Kanzleramt und Charisma soll er nun versuchen, seinen eigenen Kurs und den seiner Partei neu zu definieren. Wie kann er damit umgehen? Was motiviert ihn jetzt? Und: Wie können wir alle uns möglicher Weise aus solchen tiefen Löchern selbst wieder herausziehen?
Ein Interview mit Dr. Stephan Lermer (Radio FFH, 29.9.09) gibt Antworten:
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer