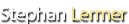Wirken weiße Autos wirklich „leiser“ (?)
Dass zum Beispiel Farben auch laut sein können kennt man vom geflügelten Wort der „schreienden Farben“. Wie sich nun speziell Autofarben auf die Empfíndung auswirken hat man erst jetzt untersucht. Das Team von Prof.Dr.Friedrich Dudenhöffer an der Universität Duisburg-Essen befragte 250 Personen, wie sie verschiedenfarbige Autos desselben Typs empfinden, die mit 30 km/h an ihnen vorbeifuhren. Dabei kam heraus, dass rote und schwarze Autos als „sportlich“ empfunden wurden, silberfarbene dafür eher als „träge“. Am erstaunlichsten war das Befragungsergebnis bei der Farbe weiß. Diese derzeit wieder sehr angesagte Autofarbe ließ alle anderen hinter sich mit dem Befund, dass 78 Prozent der Befragten weiße Autos als „eher leise“ bzw. „extrem leise“ einstuften. Es ging noch weiter mit der Favorisierung von weiß, indem 71 Prozent angaben, das Fahrgeräusch der weißen Autos sei „angenehm“. Übrigens signifikant im Kontrast zu grünen Autos, deren Geräusch als eher „unangenehm“ bewertet wurde.
Vielleicht werden ja auch deshalb so viele weiße Autos gekauft, weil sie so angenehem leise wirken? Ein aufregender Start für zukünftige Forschungen, wie sich Autofarben anhören.
Experimentstudie: Autofarben machen „Geräusche“. Absatzwirtschaft 02.01.2013
Der Teufel trägt Prada?
Harvard-Studie zu den psychologischen Auswirkungen von Luxusgütern
Mahatma Ghandi war der Meinung, dass „ein gewisses Maß an Harmonie und Komfort notwendig ist. Alles aber, was über dieses gewisse Maß hinaus geht, ist eher ein Hindernis, denn eine Hilfe.“
Die Psychologen Roy Chua und Xi Zou von der Harvard Business School gingen Ghandis Beobachtung nach und untersuchten die Auswirkungen von Luxusgütern auf mentale Prozesse, Einstellungen gegenüber anderen und soziale Entscheidungen.
In einer Hinsicht bestätigen sie Ghandi schon einmal: Beschäftigung mit und Besitz von Luxusartikeln aktivieren eigennützige Einstellungen. Sie beeinflussen unsere Wahrnehmung und die Informationsverarbeitung unseres Gehirns und damit letztlich auch unsere Entscheidungen. Kurz: Wenn wir mit Luxusartikeln konfrontiert werden, denken wir mehr an uns selbst. Aber hat das auch Auswirkungen auf andere? Chua und Zou stellen in ihren Experimenten fest:
a) Luxus führt nicht zwingend dazu, dass wir uns ‚fies‘ gegenüber anderen verhalten, aber er leitet Prozesse ein, die uns dazu verleiten, mehr an uns selbst und weniger an andere zu denken.
b)Luxus wirkt sich auf unser Entscheidungsverhalten derart aus, dass wir eher unsere eigenen Belange im Auge haben und mehr in Richtung Profitmaximierung entscheiden.
c)Luxus aktiviert zwar eigennützige psychische Konzepte, jedoch nicht die Tendenz, anderen zu schaden.
Die Harvard-Forscher folgern also, dass Luxus den Menschen nicht automatisch zum Teufel werden lässt, der rücksichtslos anderen Gruben gräbt, um seine Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Luxus führt lediglich dazu, dass wir ein bisschen mehr auf uns selbst achten. Und das kann durch aus seine positiven Seiten haben.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: hbswk.hbs.edu
Was unser Gesicht über Aggressivität verrät
Nicht nur über Worte und Gesten können wir feststellen, ob unser Kommunikationspartner ein aggressiver Mensch ist. Allein ein kurzer Blick in die Gesichtszüge genügt.
Das berichten Dr. Justin Carré und seine Kollegen von der Brock University of Ontario, Kanada. In ihrem psychologischen Experiment gingen sie der Frage nach, ob es möglich ist, die Tendenz zu aggressivem Verhalten mit einem kurzen Blick in die Gesichtszüge des Gegenübers einzuschätzen. Dazu zeigten sie ihren Versuchspersonen Bilder von Männern, deren Aggressivität sie zuvor im Labor untersucht hatten.
Obwohl alle Männer auf den Bildern einen neutralen (‚un-emotionalen‘) Gesichtsausdruck aufgesetzt hatten, filterten die Versuchspersonen erstaunlicherweise recht zuverlässig die aggressiven Männer heraus. Und zwar unabhängig davon, ob sie die Bilder eingehend betrachten durften oder nur ganz kurz (für 39 Millisekunden) gezeigt bekamen.
Dr. Carré und sein Team erklären ihren interessanten Befund damit, dass wir zur Einschätzung der Aggressivität von Unbekannten (schnelles Entscheiden kann hier überlebenswichtig sein!) einen sehr groben, aber ungemein zuverlässigen Indikator heranziehen: Die sogenannte width-to-height ratio (WHR), sprich: Das Verhältnis der Entfernung vom linken zum rechten Wangenknochen und der Entfernung von der Oberlippe zu den Augenbrauen.
Während Jungen und Mädchen in der Kindheit keinen Unterschied in der WHR zeigen, entwickeln junge Männer in der Pubertät eine größere WHR. Untersuchungen bei jungen Männern haben außerdem gezeigt, dass solche mit einer größeren WHR auch tendenziell mehr aggressives Verhalten zeigen.
Tatsächlich ging im Expreiment von Dr. Carré die Einschätzung aggressiven Verhaltens mit einer größeren WHR einher – welche wiederum proportional zur vorher festgestellten Aggressionsneigung der Männer war.
Die Ergebnisse belegen, dass beinahe unmerkliche Unterschiede in der Gesichtstruktur anderer Menschen sehr stark unsere Einschätzung und unser Verhalten gegenüber diesen Menschen beeinflussen können.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Carré, JM, McCormick, CM, Mondloch, CJ (2009). Facial Structure is a Reliable Cue of Aggressive Behavior. Psychological Science, 20 (10)
Psychologische Begriffe: Chamäleon-Effekt
Sind wir menschliche Chamäleons. Es scheint so: Unbemerkt von anderen und sogar von uns selbst passen wir uns den Verhaltensweisen unserer Interaktionspartner an. Mit gutem Grund.
Haben Sie schon einmal darauf geachtet, dass Sie sich nach vorne lehnen, wenn sich Ihr Gesprächspartner nach vorne lehnt? Oder dass Sie die Arme verschränken, wenn Ihr Gegenüber das tut? Oder dass Sie auf ‚Heimaturlaub‘ andere Ausdrücke, Gesten und Mimik benutzen als sonst irgendwo auf der Welt in Ihrer Freizeit?
Wir imitieren täglich unsere Kommunikationspartner – und das zumeist unbewusst. In einschlägigen Kursen zum Neurolinguistischen Programmieren können Sie das allerdings auch bewusst lernen. Eine Basisübung besteht dort nämlich darin, den Gesprächspartner zu spiegeln – in Haltung, Mimik, Gestik und sogar verbal. Der Grund: Das Imitieren schafft Sympathie. Denn Sympathie mit einem anderen Menschen empfinden wir zuverlässig immer dann, wenn wir eine gewisse Ähnlichkeit miteinander feststellen – in Worten und Taten. „Hey, der ist wie ich!“ – klingt doch sympathisch, oder?
Doch eigentlich brauchen wir keine Kurse für unser Imitationsverhalten. Wir imitieren ganz natürlich, weil wir spüren, dass andere das mögen. Diese Mimikry ist sogar so tief in uns verankert, dass wir oft gar nicht anders können. Schuld daran sind Schaltkreise im Gehirn, bei denen so genannte Spiegelneuronen aktiv sind (siehe unseren Blog-Beitrag vom 22.7.09).
Am Max-Planck-Institut in Leipzig werden seit einigen Jahren Versuche zum menschlichen Imitationsverhalten durchgeführt. Eines der faszinierendsten zeigt, dass wir nicht nicht imitieren können: Der Neuropsychologe Roman Liepelt zeigte einem Teil seiner Versuchsteilnehmer Fotos von Händen, bei denen zwei Finger durch ein Gestell fixiert waren. Dabei sollten sie mit ihren eigenen Fingern per Tastendruck Reaktionsaufgaben meistern. Das erstaunliche Ergebnis: Sahen die Teilnehmer die fixierten Finger, konnten sie ihre eigenen Finger nur noch erheblich langsamer bewegen! Die simultane Aufzeichnung ihrer Gehirnaktivität zeigte, dass dabei ihre Spiegelneuronen involviert waren.
Fazit: Was der Kommunikationspsychologe Paul Watzlawick allgemein über Kommunikation sagte („Man kann nicht nicht kommunizieren“), gilt speziell auch für Imitation: Wir können nicht nicht imitieren. Und das ist gut so. Denn Imitation schafft Vertrauen. An der Universität von New York imitierten die Psychologen Tanya Chartrand und John Bargh ihre Versuchsteilnehmer und wurden anschließend als wesentlich sympathischer von ihnen eingeschätzt als ohne Imitation.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Lost in Translation.
Asiaten tun sich in der Regel schwerer als Angehörige des westlichen Kulturkreises damit, emotionale Gesichtsausdrücke einzuordnen.
Rachael E. Jack von der Universität Glasgow erklärt in ihrer wissenschaftlichen kulturvergleichenden Studie, warum: „Östliche und westliche Teilnehmer unserer Studie sahen sich schlicht und ergreifend andere Ausschnitte der Gesichter an, die wir ihnen zeigten.“ Die Forscherin legte ihren Probanden Fotos von Personen vor, die Gefühle zeigten – etwa Trauer, Freude, Ärger oder Ekel.
^_^ oder 🙂 ? Was drückt in Ihren Augen besser ‚Freude‘ aus?
Normaler Weise werden diese Emotionen im ganzen Gesicht ausgedrückt. Augen Mund, Nase, Stirn, alle Gesichtsteile machen den Ausdruck der Emotion mit und die dahinter stehenden Gefühle damit für andere sichtbar. Im Experiment veränderte Rachael Jack einige der Bilder jedoch so, dass einige Gesichtsteile ’neutral‘ blieben, während andere ganz klar Emotionen ausdrückten. Während die Versuchsteilnehmer die gezeigten Gefühle einordneten, maß sie deren Augenbewegungen und Blickrichtung mittels Elektrookulografie (Eye Tracking).
Dabei stellte sie fest, dass asiatische Teilnehmer beinahe ausschließlich die Augenpartie für die Gefühlseinschätzung betrachteten, während die Blicke der westlichen Versuchsteilnehmer das gesamte Bild scannten. Dem entsprechend fiel es den Asiaten schwerer als Europäern, Emotionen zu benennen, wenn die Augenpartie neutral belassen wurde.
Bei den sogenannten „Emoticons“ zeigt sich die kulturelle Prägung beim Emotionsausdruck besonders anschaulich:
Im Chatroom drücken ostasiatische Teilnehmer Freude mit ^_^ aus und Trauer mit ;_;
Die kritische Veränderung findet hier also bei der Augenpartie statt, während Europäer die Augen unverändert lassen und die Mundpartie betonen: Freude wird mit 🙂 gezeigt und Trauer mit 🙁
Die Studie zeigt recht anschaulich, dass in puncto interkultureller Kommunikation auch und vor allem auf die nonverbalen Signale geachtet werden muss. Ein Beispiel: Europäer zeigen aus Höflichkeit oft das sogenannte „Flugbegleiter-Lächeln“, indem sie die Mundwinkel nach oben ziehen und das restliche Gesicht unverändert lassen (Selbstversuch: das ‚echte‘ Lächeln passiert übrigens mit Mund UND Augen!). Asiaten tun sich mit der Interpretation dieses ‚Gefühlsausdrucks‘ zurecht schwer. Während man dieses Lächeln in Europa aus kulturellen Konventionen automatisch als Wohlwollen und Freundlichkeit interpretiert, werden für Asiaten hier eigentlich inkongruente Botschaften gesendet: Man verzieht die Mundwinkel (wie es Asiaten auch tun würden), aber man ‚lächelt‘ nicht, denn sonst würde man die Augen (mit-)benutzen.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Cell Press (2009, August 16). Facial Expressions Show Language Barriers, Too. ScienceDaily. Retrieved August 17, 2009, from http://www.sciencedaily.com /releases/2009/08/090813142131.htm
Hot or not? Männer sind sich einig. Frauen nicht.
Einer neuen Studie des Psychologen Dustin Wood von der Wake Forest University in Winston-Salem nach, ist der Konsens unter Männern bei der Beurteilung von Attraktivität weitaus höher als der bei Frauen.
„Männer sind sich sehr stark darüber einig wen sie attraktiv finden und wen unattraktiv, Frauen hingegen denken differenzierter,“ so Wood. „In unserer Studie konnten wir diesen offensichtlichen Geschlechterunterschied erstmals objektiv zeigen“.
In ihrem Experiment bewerteten über 4000 Teilnehmer zwischen 18 und 70 Jahren die Attraktivität von Männern und Frauen auf Fotos im Alter zwischen 18 und 25 Jahren auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht attraktiv) bis 10 (sehr attraktiv).
Bevor die Teilnehmer die Attraktivität der Personen auf den Bilden einschätzten, wurden die Bilder erst einmal von dem Forscherteam selbst eingestuft, je nach dem wie verführerisch, selbstsicher, dünn, sensibel, modisch, kurvenreich (Frauen), muskulös (Männer), traditionell, männlich/weiblich, klassisch, gepflegt oder fröhlich die Personen aussahen. Dies half den Forschern als Marker, welche Merkmale einen besonderen Einfluss haben könnten.
Das Ergebnis: Die Urteile der Männer basierten größtenteils auf der physischen Attraktivität der Frauen: Am attraktivsten wurden vor allem Frauen mit einem schlanken, verführerischen Äußeren eingestuft. Eine kleine Überraschung fand man dennoch: Auch Frauen, die selbstsicher wirkten, wurden als attraktiver eingeschätzt.
Frauen zeigten zwar eine gewisse Tendenz für schlanke, muskulöse Männer, aber sie waren sich im Großen und Ganzen sehr uneinig darüber, wer attraktiv ist und wer nicht. Manche Frauen bewerteten Männer als sehr attraktiv, die zuvor von anderen Frauen als überhaupt nicht attraktiv bewertet wurden.
Die Studie habe wichtige Implikationen für die unterschiedlichen Strategien der Geschlechter bei der Partnersuche, so Wood. Seine Argumentation: Frauen werden mit weniger Wettbewerb um den Angebeteten konfrontiert werden, Männer hingegen müssen mehr Zeit und Energie in ihre Wunschpartnerin investieren, und sie dann noch vor anderen Interessenten bewachen.
„Die Studie zeigt außerdem, warum es für Frauen wichtiger ist, ihre physische Attraktivität aufrechtzuerhalten. Frauen, die Männer beeindrucken wollen, haben mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Erfolg, wenn sie gewisse physische Standards erfüllen. Obwohl auch Männer, die diesen Standards entsprechen, als attraktiver eingeschätzt werden – insgesamt ist ihre Bewertung nicht so stark an körperliche Merkmale gebunden,“ meint Dustin Wood.
Zeit für die Männer, ihr Attraktivitätsrating noch einmal zu überdenken: gibt es neben der physischen Attraktivität noch andere Vorzüge an potentiellen und realen Partnerinnen? Finden und loben Sie diese. Frauen fahren sehr erfolgreich mit dieser Strategie. Und geben zudem häufiger an, den ‚Richtigen‘ gefunden zu haben.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: www.wfu.edu/news/release/2009.06.25.a.php, Homepage der Wake Forest University