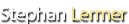Depressiv durch TV-Konsum?
Fernsehen informiert und amüsiert. Es verschafft uns wichtige Anregungen und ist in der Lage, unsere Stimmung zu beeinflussen. Und nicht zuletzt fördert es unsere Selbstwirksamkeit und Entscheidungsfreude, sofern wir (und nicht unsere nächsten Angehörigen) die Macht über die Fernbedienung haben. Soweit zur Theorie.
In der Praxis zeigt sich nun ein erstaunlicher Befund: Forscher der University of Pittsburgh nahmen den TV-Konsum genauer unter die Lupe und verglichen die tägliche Fernsehzeit von Jugendlichen mit dem Risiko, eine Depression zu entwickeln. Die insgesamt 4142 Jugendlichen notierten dabei über 7 Jahre hinweg, also bis ins junge Erwachsenenalter ihre Gewohnheiten im Umgang mit Medien.
Die Teilnehmer, die zu Beginn der Studie keine depressiven Symptome aufwiesen, waren durchschnittlich für 5,68 Stunden täglich Medien ausgesetzt. 2,14 Stunden verbrachten sie davon mit fernsehen.
Gemäß der Studie führte schon ein geringfügig höherer TV-Konsum zu einem kleinen, aber bedeutenden Anstieg des Depressionsrisikos, insbesondere bei männlichen Jugendlichen.
Die Forscher um Brian Primack vermuten, dass die durch den vermehrten TV-Konsum verringerten sozialen Kontakte für das höhere Depressionsrisiko verantwortlich sind. Auch mangelnde kommunikative Fertigkeiten infolge einseitiger Rezeption der Inhalte wäre ein möglicher Grund. Durch die fortwährende Präsentation „perfekter“ Menschen im TV würden sich außerdem Selbstwertprobleme einstellen.
Eine wichtige Rolle scheint vor allem die Auswahl der TV-Inhalte zu spielen. Man sollte im Allgemeinen eher solche medialen Happen genießen, die man auch verdauen kann. Außerdem sollte man sich mit den aufgenommenen Informationen kritisch auseinander setzen – am besten im Dialog mit wichtigen Bezugspersonen. So schult man die eigenen kommunikativen Kompetenzen.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Primack, B. et al. (2009). Association between media use in adolescence and depression in young adulthood: a longitudinal study. Archives of general Psychiatry, 66, pp. 181-188
Depressiv aus Nächstenliebe?
Eine wohltätige Spende hilft in der Regel nicht nur dem Empfänger, sondern auch dem Geber.
Während der Empfänger von der materiellen Unterstützung profitiert, genießt der Spender das Gefühl, Hilfe geleistet zu haben – Selbstwert und Selbstwirksamkeit werden gesteigert. Das schafft kurzfristig positive Gefühle und bildet langfristig eine gute Grundlage für Sinnempfinden und ein reiches Sozialleben.
Psychologische und soziologische Forschung bescheinigt Menschen, die sich derart altruistisch verhaltenin der Regel auch ein glücklicheres Leben. So weit, so gut. Ein diskussionswürdiges Ergebnis lieferte jetzt allerdings eine Studie mit Daten des National Survey of Midlife Development in the U.S.: Regelmäßige Spender haben ein 2,6-faches Risiko, an Depressionen zu erkranken.
Ein möglicher Grund für die die Aufsehen erregenden Daten ist, dass bereits vor der Depression bestehende Schuldgefühle die ‚Anfälligkeit‘ für Spendenbereitschaft erhöhen. Damit wäre die Spendenbereitschaft ein ‚Symptom‘ einer depressiven Grunderkrankung, das auftreten kann, aber nicht muss. Denkbar wäre auch , dass der verringerte Selbstwert, der oft mit depressiven Erkrankungen einhergeht, das Ablehnen von Spendenanfragen verhindert. Oder dass das Spenden eine Art ‚Eigentherapie‘ darstellt, die depressive Schuldgefühle verringern kann.
Eine wichtiges Manko der Studie ist allerdings, dass die Forscher nur Geldspender untersuchten. Direkte, aktive Hilfe sowie emotionale Zuwendung zu Bedürftigen wurden nicht in die Analyse miteinbezogen.
Hier zeigt die psychologische Forschung allerdings konsistent, dass tätige Hilfe und emotionale Unterstützung vor Depressionen und Ängsten schützen. Wie unser Blog-Beitrag vom 3.3.09 zeigt, haben auch Geldspenden normaler Weise langfristige positive Folgen für den Spender. Die Forschung ist in diesem Gebiet wohl etwas inkonsistent.
Vielleicht sollte man vor der nächsten Geldspende einfach kurz seine Motive hinterfragen. Hier kann eine Visualisierung der Ergebnisse nützlich sein: Stellen Sie sich vor, was mit dem Geld gemacht wird, wo es hinkommt, wer es erhält. Wenn Sie dabei Freude und Mitgefühl empfinden: Füllen Sie den Spendentopf. Falls Sie Erleichterung oder Schuld verspüren: Kaufen Sie sich selbst etwas Schönes und nehmen Sie sich die Zeit, aktiv tätig und unmittelbar zu helfen. Denn das schützt vor Depressionen, so viel ist wenigstens sicher!
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Fujiwara, T. et al (2009). Is altruistic behavior associated with major depression onset? PLoS ONE, 4(2), e4557
Reden hilft
Seit Wochen schon kriselt es. Die Ausprache gestern war eine Farce. Es war falsch, was er behauptet hat. Es war demütigend, verletzend und vor allem falsch. Den ganzen Tag schon plagen Sie Gefühle von Ärger und Enttäuschung.
Beim Mittagessen treffen Sie einen Bekannten. Während des Gesprächs denken Sie an die misslungene Aussprache. Sie sind unkonzentriert. Als Ihr Gesprächspartner es merkt und fragt, was los sei, erzählen Sie es ihm. Er hört gut zu und fragt geschickt und unaufdringlich nach. Nach und nach fühlen Sie sich besser. Sie merken, wie Ihr Ärger und Ihre Enttäuschung nachlassen. Sie beschließen, das Thema noch einmal anzusprechen und eine Lösung zu finden.
Sich den Frust von der Seele zu reden hilft wirklich. Ein Freund, ein Therapeut oder ein Bekannter, der bereit ist, Informationen vertraulich zu behandeln – sie alle können mehr oder weniger helfen, negative Gefühle besser zu verarbeiten und Probleme lösungsorientiert anzugehen oder in einem neuen Licht zu sehen.
Die Hirnforschung bestätigt diese uralte Weisheit jetzt mit Hilfe neurophysiologischer Belege. Forscher der University of California entdeckten Gehirnareale, die für die Emotionsregulation während Gesprächen über negative Sachverhalte verantwortlich sind. Ihre Probanden sahen Bilder von traurigen oder verärgerten Menschen, während ihre Gehirne mittels funktioneller Magnetresonanztomografie untersucht wurden.
Die Probanden hatten zunächst die Aufgabe, den Personen, die sie sahen, Namen zu geben. Anschließend sollten sie die Gefühle der Menschen beschreiben. Im Vergleich zu einer Versuchspersonengruppe, die die Bilder einfach nur beschreiben sollten, war bei den Probanden, die den Bildern Namen gaben, die Amygdala aktiver – eine Gehirnregion, die für das Erkennen von negativen Emotionen und die Reaktion darauf zuständig ist. Sie gaben auch an, stärker emotional von den Bildern betroffen zu sein.
Während der anschließenden Beschreibung der Gefühle der Personen auf den Bildern ging die Amygdala-Aktivität allerdings deutlich zurück – sogar unter das Ausgangsniveau der Gruppe, die die Bilder einfach nur beschreiben sollte und damit keinen persönlichen emotionalen Bezug dazu hatte. Zugleich zeigte der ventrolaterale präfrontale Cortex (VLPC) bei der Beschreibung der Gefühle stärkere Aktivierung.
Der VLPC ist an der Impulskontrolle beteiligt und könnte helfen, starke emotionale Reaktionen zu unterdrücken. Dies könnte wiederum zur Folge haben, dass wir uns beruhigen, Abstand gewinnen und so wieder klar und lösungsorientiert denken können.
In den nächsten Jahren wird die Hirnfoschung weitere grundlegende Erkenntnisse über die Wirkungsweise heilender Gespräche zu Tage fördern. Sicher ist: Über Probleme, Ärger und Enttäuschungen bewusst zu sprechen trägt enorm zu deren Bewältigung bei.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Lieberman, M. et al. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. Psychological Science, 18, pp. 421-428
Depressionen ? Gehen Sie in die Kirche.
Klar gibt es immer wieder einmal Stimmen,
die dem Weihrauch eine lungenverpestende
Wirkung zuschreiben. Und man kann auch
nicht verhehlen, dass der in der Kirche verglimmende
Weihrauch einen Feinstaubwert erzeugt, der die
EU-Richtwerte um ein zigfaches übersteigt.
Aber lassen Sie uns von der heilenden Wirkung
des kirchlichen Weihrauch-Einsatzes sprechen:
Nicht nur ein olfaktorisches Zeichen: Hier riech
ich Weihrauch, hier ist Gott nicht weit, oder,
hier riech ich Weihrauch, schon fühl ich mich
angekommen, im Schoß der Kirche. Hinzu kommen all die
kindlichen Erinnerungen, speziell auch an
essentielle Lebenslauf-Highlights wie
erste Kommunion, Firmung, Hochzeit, Taufe …
Es ist darüber hinaus noch viel mehr:
Dieses „Opium fürs Volk“ hat es faustdick in
seiner Rauchschale: Weihrauch wirkt unbewusst
auf den Organismus. Und zwar therapeutisch :
Wissenschaftler aus Israel haben herausgefunden,
dass Weihrauch via bestimmter Ionenkanäle direkt
unser Gehirn beeinflusst: So werden Depressionen und Ängste
werden nachweislich gelindert.
Gerade in unserer heutigen Zeit,
wo neuerdings Depressionen einerseits zu den
Fehlzeiten-Hits der jährlichen Krankheitstage zählen,
andererseits unser absurdes Gesundheitskostensystem
die Depressionsbehandlung letztlich dem Einzelnen
überlässt, ist diese Meldung sicher für viele eine
erfreuliche Lösung: Kostenlose Stimmungsaufhellung
im Gotteshaus.
Die Kirchen werden sich freuen, wenn
wieder mehr Besucher kommen, und sei es nur zum
Gesundschnüffeln. Und nicht zuletzt dürfte es auch den Heiland freuen, wenn der Besuch bei ihm ein bisschen „high“ macht.
Quelle: Faseb Journal 2008
P.s.: Morgen lesen Sie, warum das „mea-culpa-Klopfen“ in der Kirche unser
Immunsystem stärkt.