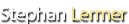Neues aus der Aufschieberitis-Forschung
Öhm..Entschuldigung, eigentlich wollten wir diesen Beitrag früher posten 😉
Es gibt Neuigkeiten aus der Forschung zur Prokrastination. Der auf dem Gebiet führende Wissenschaftler Dr. Piers Steel hat – nach nur 10 Jahren – ein umfangreiches Werk veröffentlicht, in dem er beschreibt und erklärt, warum und wie wir wichtige Dinge aufschieben. Seine wichtigsten Schlussfolgerungen:
- Die meisten Selbsthilferatgeber liegen falsch: Prokrastination ist nicht die Folge von Perfektionismus.
- Macht man zu Neujahr die besten Vorsätze, ist das meist zum Scheitern verurteilt.
- Das menschliche Aufschiebeverhalten ist mit einer einzigen mathematischen Formel beschreibbar.
Zunächst beschreibt Steel aber, was einen typischen „Aufschieber“ von einem gewissenhaften Menschen unterscheidet, der in der Regel seine Projekte pünktlich abschließt: „Aufschieber haben generell weniger Selbstvertrauen und speziell weniger Vertrauen darauf, dass sie die anfallenden Aufgaben auch tatsächlich bewältigen können.“ Die bisherige Vermutung, dass vor allem Perfektionisten die Dinge aufschieben, weil sie sich nicht sicher sind, dass ihre Projekte eigenen oder fremden Standards genügen, widerlegt er und behauptet statt dessen: „Perfektionisten schieben in Wahrheit weniger auf. Allerdings machen sie sich um das Aufschieben viel mehr Sorgen.“
Was sind aber die wahren Ursachen der Aufschieberitis? Steel zählt auf: Bedenken wegen der Aufgabe, Impulsivität, ein Hang zur (Selbst-)ablenkung, und Leistungsmotivation. Dabei bedeutet nicht jedes Aufschieben gleich (krankhafte) Prokrastination. Entscheidend ist, dass man glaubt, es wäre besser, nun anzufangen, aber trotzdem eben nicht anfängt.
Wenn Sie sich jetzt selbst ein wenig schuldig fühlen, sind Sie in guter Gesellschaft: Fast jeder Mensch durchlebt akute Phasen der Prokrastination, 15-20% der Bevölkerung sind chronische Aufschieber. Steel belegt, dass vor allem Impulsivität und das Vorhandensein von ablenkenden Aktivitäten Prokrastination begünstigen. Die Fernbedienung auf dem Tisch neben uns und die Kollegin, die sich so gerne zwischendurch mit uns unterhält sind wohl die besten Beispiele für Anreize, denen wir impulsiv nachgeben.
Die gute Nachricht: Willenskraft hilft enorm gegen impulsives Verhalten und selbstgewählte Ablenkung. „Ob man nun glaubt, dass man es schafft oder ob man es nicht glaubt – meist hat man recht. Und wenn man mehr Selbstkontrolle gewinnt, steigt zunächst die Erwartung, dass man es schafft, den Verlockungen und Ablenkungen der Umwelt zu widerstehen. Das wiederum verbessert die eigene Fähigkeit, die wichtigen Dinge gleich anzupacken“ weiß Steel.
Abschließend meint er mit einem Augenzwinkern: „Prokrastination greift gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten um sich. Deshalb: Forschungsbemühungen zur Prokrastination sollten gerade jetzt auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden.“
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: University of Calgary, 2009. We’re sorry this is late…Research into procrastination shows surprising findings
Besser entscheiden mit Psychologie
Auf Grund der uralten Einsicht, dass nicht alles menschliche Verhalten rational ist und der Möglichkeit neuer Forschungsmethoden erlebte Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts die Verbindung von Psychologie und Wirtschaftswissenschaften eine Renaissance: Mit Hilfe der Tools der Verhaltensökonomie konnten Forscher nun weitaus besser als zuvor das (ir-)rationale Entscheidungsverhalten des Homo sapiens erklären und vorhersagen.
Bevor Sie sich nun wertvolle Tipps für bessere Entscheidungen abholen, sind Sie herzlich eingeladen, ein paar Zeilen zur Prospect Theory (siehe Beitrag vom 09.09.09) zu lesen. Obwohl die meisten Untersuchungen zur Prospect-Theorie aus dem wirtschaftlichen Kontext stammen, gilt die Theorie jedoch für alle Bereiche unseres Entscheidungs-Lebens. Zeit also, dass Sie ein paar dieser Fehler kennen lernen, um sie in Zukunft zu vermeiden. Ab jetzt können Sie gerne jeweils Donnerstags unsere kleine Serie ‚Besser entscheiden mit Psychologie‘ nutzen. Viel Spaß beim Experimentieren mit den Ergebnissen der Verhaltensökonomik!
Teil 2 – Die Verlustaversion
Stellen Sie sich vor, wir würden Ihnen jetzt 500€ geben und Ihnen noch eine zusätzliche Chance bieten: Sie müssen zwischen 2 Optionen wählen. Bei Option (a) erhalten Sie sicher noch einmal 250€ dazu. Bei Option (b) werfen Sie eine Münze. Fällt Zahl, bekommen Sie noch einmal 500€. Fällt Kopf, erhalten Sie zusätzlich nichts. Welche Option würden Sie wohl wählen?
Ein anderes Beispiel: Nun geben wir Ihnen 1000€. Wieder müssen Sie zwischen 2 Optionen wählen. Bei Option (c) verlieren Sie ganz sicher 250€. Bei Option (d) werfen Sie wieder die Münze. Fällt Kopf, verlieren Sie 500€, bei Zahl verlieren Sie nichts.
Wie haben Sie sich jeweils entschieden? Die Forschung zeigt, dass sich Menschen in der Regel für die Optionen (a) und (d) entscheiden.
Natürlich sind eigentlich alle Alternativen (a)-(d) völlig gleichwertig. Trotzdem wählen wir, wenn wir mit einem drohenden Verlust konfrontiert werden (Option (c)) lieber die risikoreiche Variante (d), weil wir irrationaler Weise hoffen, den Verlust noch abwenden zu können. Ein derartiges ‚Spiel‘, wie wir es Ihnen oben angeboten hätten, kann man noch leicht durchschauen: Wir könnten sehr rasch die Wahrscheinlichkeiten der Gewinne und Verluste mit den Werten der Outcomes verrechnen und würden bemerken, dass wir uns in allen Fällen zwischen gleichwertigen Alternativen entscheiden müssten.
In der Realität kennen wir allerdings in der Regel nicht alle möglichen Ergebnisse und Wahrscheinlichkeiten für Gewinne und Verluste. Und so bleibt unser „Bauchgefühl“ übrig, das uns Verluste vermeiden lässt, größere Risiken bei drohendem Verlust eingehen lässt, uns sichere Gewinne trotz besserer Chancen bei Wiederanlage dieser Gewinne einbehalten lässt – und uns definitiv täuscht.
Die fundamentale Wahrheit hinter der Verlustaversion lautet: Menschen gehen erhebliche Risiken ein, um Verluste auszugleichen. Das führt zum Beispiel dazu, dass Spieler Ihre Einsätze erhöhen, wenn sie in den roten Zahlen sind, auch wenn ihre Gewinnchancen geringer werden. Oder dass Investoren an der Börse weniger dazu bereit sind, Wertpapierezu verkaufen, die ihnen Verluste eingebracht haben, obwohl die Chancen auf Besserung der Kurse nicht größer geworden sind. Oder dass wir es ungerecht finden, wenn ein Unternehmen auf Grund von Umsatzeinbußen die Löhne um 7% senkt, bei einer Inflationsrate von 0%. Wohingegen wir es weniger moralisch verwerflich finden, wenn dasselbe Unternehmen die Löhne um 5% anhebt, bei einer Inflationsrate von 12%.
Genau wie bei der Ankerheuristik (siehe Blog-Beitrag vom 10.9.09) helfen bei der Verlustaversion objektive Daten. Gerade dann, wenn Sie etwas verloren haben, sollten Sie nicht auf Ihre Gefühle hören, sondern Ihre Ratio bemühen und möglichst viele objektive Informationen suchen. Ein Verlust kann Ihnen somit als Warnung dienen. Er sagt Ihnen: Verstand einschalten, kühl kalkulieren und die heißen Emotionen vorerst weglassen.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Psychologische Begriffe: „Hochstapler-Syndrom“
Kennen Sie diese Situation: Sie haben ein Projekt sehr erfolgreich abgeschlossen und nun werden Sie von allen Seiten dafür gelobt und beglückwünscht. Sie freuen sich zwar über Ihre offensichtlich gute Leistung, haben aber das Gefühl, dass alle übertreiben und Sie doch eigentlich gar nichts Besonderes gemacht haben?
Menschen, die dieses Gefühl jedes mal befällt, wenn sie für etwas Tolles belohnt werden, leiden womöglich am sogenannten „Hochstapler-Syndrom“.
Ulrike Folkerts ist ein gutes Gegenbeispiel. Als ihr vor einiger Zeit ein Preis aufgrund ihrer großen Beliebtheit als „Tatort-Kommissarin“ verliehen wurde, kam sie auf die Bühne und meinte mit fester Stimme: „Ich finde, das habe ich verdient.“
Ein solches Verhalten überrascht uns geradezu, vor allem bei Frauen. Fachärztin Astrid Vlamynck aus Berlin schreibt dies den verankerten Rollenbildern zu. Eine Erziehung, die darauf abzielt, eine Frau zu einer guten Hausfrau und Mutter zu machen, wird einer Karrierefrau irgendwann Probleme bereiten.
Experten bezeichnen diese spezielle Form des Minderwertigkeitskomplexes als „Hochstapler-Syndrom“. Die Betroffenen halten sich dabei unbewusst für „Hochstapler“ und haben Angst, dass sie entlarvt werden könnten. Und dies, obwohl sie in Wahrheit keine sind, denn sie arbeiten hart und beweisen Fleiß, Talent und Erfolg.
Die vermutlichen Ursachen liegen in frühkindlichen Erfahrungen und bestimmten Familienstrukturen. Eltern sprechen meist nur in den besten Tönen von ihren Kindern. Sie halten ihren eigenen Nachwuchs für besser, klüger und schöner als das Durchschnittskind. Bekommt das Kind nun diese „Lobhudelei“ mit, hält sich selbst aber gar nicht für so gut, kann es zu dem Gefühl kommen, schlechter zu sein, als die anderen von ihm denken.
Derselbe Effekt kann sich aber auch ergeben, wenn genau das Gegenteil der Fall ist: Die Eltern unterschätzen ihr Kind und loben nur die Geschwister. Daraus kann das Gefühl entstehen, ’nicht gut genug zu sein‘.
Was kann man tun, wenn man das Gefühl hat, öfters dem Hochstapler-Syndrom zu unterliegen? Ob Mann oder Frau: Wir müssen lernen, aktiv unser Selbstbewusstsein zu stärken. Hilfreich dabei können vor allem nahestehende Personen sein, die uns ehrliches, aber respektvolles und wertschätzendes Feedback geben können. So wird der Weg geebnet für eine realistischere Selbsteinschätzung.
Dieses Selbst-Bewusstsein führt langfristig zu mehr Selbst-Vertrauen. Und dann können wir uns selbst und allen anderen endlich auch sagen: „Danke! Diesen Erfolg habe ich wirklich verdient.“
Positive Selbst-Statements: Nutzen und Gefahr
„Du musst nur alles positiv sehen, dann wird das schon!“ Dutzende Selbsthilfe-Bücher und Ratgeber legen uns diese Universalformel nahe: Zuerst kommt das positive Denken, dann kommt der Erfolg, die Heilung, die Versöhnung, ein langes Leben in Glück und Zufriedenheit. Affirmative Phrasen sind laut diesen Ratgebern meist der einfachste Weg zu mehr Optimismus: Sich ständig vorzusagen, dass man „es schaffen wird“, dass „heute ein guter Tag wird“ und Ähnliches.
Doch so einfach ist es nicht. Fest steht: Eine positive, freundliche, extravertierte und lebensbejahende Grundhaltung ist tatsächlich ein wichtiger Faktor für Glück und Erfolg. Optimismus schützt uns zudem vor körperlichen und seelischen Leiden und hilft uns, schneller über Rückschläge hinwegzukommen.
Fest steht aber auch: Eine optimistische Grundhaltung ist nicht ausschließlich über solche Phrasen zu erreichen. Und: Optimismus ist kein ‚Allheilmittel‘. Verliert man einen geliebten Menschen, so braucht man eine angemessene Zeit der Trauer. Erst danach soll und darf langsam der Optimismus zurückkehren. Und gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass wir unsere Situation realistisch beurteilen. Und nicht mit der rosaroten Brille geradewegs ins Verderben rennen.
Gut belegt ist zu Beispiel der sogenannte ‚depressive Realismus‘. Er bezeichnet das Phänomen, dass wir in Phasen schlechter Stimmung uns selbst und unsere Umgebung objektiver und realistischer beurteilen. Der Nutzen davon ist eben, dass eine realistische Neubewertung der Situation stattfindet. So wird der Weg zu einem Neustart geebnet, der auf den besten – weil korrekten – Informationen über uns selbst und unsere Möglichkeiten aufbaut.
Joanne Wood, Professorin der Psychologie und ihre Kollegen von der University of Waterloo (Ontario) untersuchten die Wirkung von affirmativen Sätzen wie ‚I can do it‘ oder ‚I will succeed‘ in Abhängigkeit des Selbstwertgefühls ihrer Versuchsteilnehmer. Dabei fanden sie, dass solche Sätze bei Personen mit hohem Selbstwertgefühl Optimismus und Selbstvertrauen weiter steigern können – nach dem Motto: ‚Wer hat, dem wird gegeben‘.
Allerdings: Personen, die von vorneherein unter geringem Selbstvertrauen litten, profitierten von diesen Sätzen nicht. Im Gegenteil: Ihr Selbstvertrauen wurde noch geringer! Wood stellt fest, dass positive Statements nur dann wirksam sind, wenn sie bestätigen, was wir sowieso schon glauben. „Wenn aber Personen mit geringem Selbstvertrauen positive Gedanken wiederholen, widersprechen sie in Wahrheit ihrer Realität. Wenn sie also sagen ‚Ich bin eine liebenswerte Person‘, werden sie gleichzeitig denken ‚Ja gut, aber nicht immer‘, oder ‚Ja, aber nicht so‘. Diese „kontradiktorischen Gedanken“ nehmen irgendwann überhand, und damit wird das geringe Selbstvertrauen verstärkt.“
Auf Grund ihrer Erfahrung und vieler weiterer Studien weiß Wood, dass positive affirmative Sätze per se hilfreich sind. Entscheidend ist allerdings, dass die für Personen mit niedrigem Selbstbewusstsein nur dann nützlich sind, wenn sie in ein breiteres Therapie- oder Selbsthilfeprogramm eingebettet sind. Hilfe zur Selbsthilfe sollte von professioneller Seite abgestimmt sein, sonst „kann sie genau den umgekehrten Effekt haben und sehr frustrierend sein“.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Wood, JV, Perunovic, W. Lee, JW (2009). Positive self-statements: Power for some, peril for others. Psychological Science, 2009 (6)
Wie Sie das Nugget Extramotivation sanft herauskitzeln
Die Gretchenfrage der Arbeits- und Organisationspsychologie lautet: Wie schafft man es, Menschen zu motivieren, so dass sie bereitwillig für gemeinsame Ziele arbeiten und gleichzeitig zufrieden sind? Letztendlich gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Einer davon ist allerdings mit Teppichen ausgelegt: Die (engl.) ‚Labeling Technique‘.
Wirkungsweise und Effektivität der Strategie zeigen sich eindrucksvoll in einem sozialpsychologischen Experiment der Northwestern University of Chicago. Vor einem Wahltag starteten die Forscher eine typische Meinungsumfrage mit einer kleinen Modifikation: Am Ende der Umfrage gaben Sie den Befragten ein Mini-Feedback. Dabei sagten sie der einen Hälfte zufällig (!) ausgewählter Teilnehmer, sie seien ‚überdurchschnittliche Bürger, die höchstwahrscheinlich politisch engagiert sind‘. Die andere Hälfte bekam das Feedback, sie seien ‚durchschnittlich in Bezug auf politisches Interessen und Engagement‘.
Exakt eine Woche später, am Wahltag, befragten die Forscher ihre Teilnehmer erneut: Waren sie zur Wahl gegangen? Und: Wie schätzten sie selbst ihr politisches Engagement ein?. Das Ergebnis: Die als ‚politisch engagiert‘ gelabelten Personen sahen sich nun auch selbst als engagierter an. Und waren eher wählen gegangen!
Generell funktioniert diese Strategie sozialer Einflussnahme in zwei Schritten: Zunächst weisen wir einer Person ein Label zu. In etwa: ‚Ich glaube, dass du ein guter Mensch bist‘ oder ‚Für diese Aufgabe sind Sie ganz besonders geeignet‘ oder eben ‚Sie sind politisch interessiert‘. Weiterhin muss eine Aufgabe vorhanden sein, die mit diesem Label verbunden ist. Beispiele: Eine ehrenamtliche Tätigkeit, ein fachlich anspruchsvolles Projekt, oder eben eine politische Wahl.
Angenommen, ein Mitarbeiter hat Probleme in seinem anspruchsvollen Projekt. Die Probleme wirken sich natürlich negativ auf seine Motivation aus. Er wird mit zunehmender Zeit das Vertrauen in seine Fähigkeiten verlieren und damit auch an Effektivität und Effizienz. Eine gute Möglichkeit, ihn durch Labeling neu zu motivieren: Erinnern Sie ihn an sein Durchhaltevermögen und seine Stressresistenz. Weisen Sie möglichst konkret auf frühere Herausforderungen hin, die er mit Hilfe dieser Fähigkeiten erfolgreich gelöst hat. Labeln Sie ihn auf diese Art und geben Sie ihm so das Gefühl, dass er diese Fähigkeiten in besonderem Maße besitzt. Das Ergebnis: Er fühlt sich besser und zeigt auch entsprechende Leistungen.
Auch Kunden, Klienten und Geschäftspartner können gelabelt werden: Weisen Sie darauf hin, dass Sie ihr Vertrauen/ihre Entscheidung in das Unternehmen ehrt und dass es gerne auch in Zukunft weiterhin rechtfertigen wollen.
Abseits vom Business bietet sich die labeling technique auch in Erziehung und Partnerschaft an.
Wenden Sie diese Strategie an, um erfolgreich zu bleiben. Wir wissen, dass Sie das können 😉
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Visionsmanagement = wichtigster Erfolgsfaktor
Wie wichtig Ziele und Vorstellungen für den eigenen Karriereerfolg sind, zeigt eine aktuelle Metaanalyse der Harvard University, die demnächst im Journal of Developmental Psychology veröffentlicht wird.
Die Studie belegt, dass die Vorstellung konkreter Lebens- und Berufsziele von Teenagern mehr zu deren Schulerfolg beiträgt als Hausaufgabenhilfe, Zwang oder Qualität der Lehre.
(Auf dem zweiten Platz hinter dem Visionsmanagement folgte übrigens der Transfer von Lernstrategien)
Die Analyse setzte am Beginn der Entwicklung konkreter Karrierepläne an: Im Jugendalter. Studien mit insgesamt über 50.000 14-16jährigen Schülern wurden mit einbezogen. Mit ca. 14 Jahren zeigen im menschlichen Gehirn diejenigen Gehirnareale einen Entwicklungssprung, die für analytisches Denken, Problemlösen, Planen und Entscheiden zuständig sind. Kindliche Träume und Wünsche von Beruf und Karriere können nun analysiert und logisch durchdacht werden.
Nancy E. Hill, Leiterin der Studie, stellt fest: „In diesem Alter beginnen sie [die Schüler] damit, Ziele, Überzeugungen und Motivationen zu internalisieren und all das zu ihrer eigenen Entscheidungsfindung zu benutzen.“ Im Erwachsenenalter setzen wir das fort, nur mit ungleich höherer Erfahrung.
Auch nach der Schulzeit hängen Karriere- und Unternehmenserfolg wesentlich davon ab, ob und welche Ziele und Visionen vorherrschen. „Advice about what to focus on helps students plan their long-term goals.“ resümiert Hill. Und die langfristigen Ziele wirken sich wiederum auf ihren Erfolg aus.
Ebenso verhält es sich im Unternehmen. Die Integration von persönlichen Visionen der Mitarbeiter mit einer anschaulichen Unternehmensvision ist vielleicht DER kritische Faktor für langfristigen Erfolg. Bindung an das Unternehmen, Arbeitsmotivation und wahrgenommener Gestaltungsspielrum steigen, Absentismus und Präsentismus gehen zurück. Effektive Kommunikation über Ziele und Visionen lohnt sich deshalb.
Voraussetzung für eine geungene Integration von Karriere- und Unternehmensvisionen sind theoretische Kenntnisse über Visionsmanagement, Kenntnis der Persönlichkeit der Mitarbeiter und praktisches Wissen über effektive Kommunikation.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Hill, N.E. et al. (2009). Tying education to future goals may boost grades more than helping with homework. Eurekaalert, public-release-date: 19-May-2009; http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-05/apa-tet051909.php