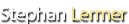Wer ist wählerischer – Mann oder Frau? Je nach Position…
„Frau natürlich!“, so die gängige Meinung in Forschung und Wissenschaft: Die Frau hat aufgrund ihrer höheren Investitionen in den Nachwuchs bei einer fehlerhaften Partnerwahl mehr zu verlieren und ist daher von „Natur aus“ kritischer bei der Partnerwahl.
Eine neue Studie widerspricht nun dieser evolutionären Hypothese.
Die Psychologen Eli J. Finkel und Paul W. Eastwick von der Northwestern University in Evanston, Illinois hatten Zweifel an den Ergebnissen zahlreicher Speed Dating Studien. Diese scheinen zu belegen, dass Männer rund 50% der anwesenden Damen wiedertreffen wollten, die Frauen dagegen nur gut ein Drittel der Männer.
Finkel und Eastwick veranstalteten daraufhin selbst eine Studie in Form eines Speed Dating Events mit 350 Teilnehmern. Der Ablauf glich dem eines klassischen Speed Datings: Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit sich mit jedem anwesenden, potentiellen Partner einige Minuten zu unterhalten. Danach bewerteten die Probanden die Gesprächspartner und gaben an, ob sie sich vorstellen könnten, den- oder diejenige wieder zu treffen.
Allerdings gab es eine pikante Variation im Vergleich zu den traditionellen Speed Datings: In der Hälfte der Fälle war es der Mann, der von Platz zu Platz rückte, so wie es der Standard in jedem konventionellen Speed Dating ist. Doch genau hier vermuteten die Forscher den Fehler. Daher war es in der anderen Hälfte der Fälle die Frau, die nach jedem Gespräch den Partner wechseln musste, während der Mann auf seinem Platz verweilte.
Das Ergebnis dieser kleinen Variation war verblüffend: Wenn die Männer den Platz wechseln mussten, waren die Ergebnisse identisch mit der gängigen Annahme. Die Männer wollten die Hälfte aller Frauen wiedersehen und die Frauen nur ein Drittel der Männer. Doch wechselten die Frauen die Plätze, verkehrte sich das Ergebnis. Plötzlich waren es die Männer, die nur ein Drittel der Frauen wiedertreffen wollten und die Frauen, diejenigen die 50% der Männer wiedersehen wollten.
Wer wählerischer war, lag also nicht am Geschlecht, sondern daran, wer sitzen blieb und wer den Platz wechselte! Die Gruppe, die rotierte, hatte das größere romantische Interesse am Partner und wollte ihn auch eher wiedersehen.
Für Finkel und Eastwick gibt es zwei mögliche Erklärungen für dieses Phänomen. Die eine ist, dass alleine das aktive Annähern an einen potentiellen Partner diesen attraktiver macht. Nach der ‚Dissonanztheorie‘ (siehe Blog-Beitrag vom 01.07.09) mögen wir nämlich Dinge und Menschen lieber, für die wir etwas getan haben – wie den Platz zu wechseln und nicht einfach nur zu warten!
Die andere Erklärung zielt auf die physische Erscheinung einer Person ab. Die Annahme dabei ist, dass Männer, wenn sie sitzen bleiben und nur die Frauen beim Platzwechsel beobachten, deren physische Attraktivität besser einschätzen können.
Was lernen wir daraus? Frauen und Männer sind sich doch etwas ähnlicher, als wir vielleicht angenommen haben, zumindest wenn es um die Partnerwahl geht. Aber die Studie hält auch einen guten Tipp bereit: Beim nächsten Date sollten unbedingt wir es sein, die schon am Platz auf unsere Abendbegleitung warten! Denn dann findet er/sie uns attraktiver, da er/sie sich uns nähert.
Wer sich für wählerisch hält, der sollte selbst einmal auf andere zugehen. Und wer immer an die Falschen gerät, sollte lieber einmal abwarten…
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: www.psychologicalscience.org/media/releases/2009/finkel.cfm, Homepage der Association for Psychological Science
Wie funktioniert erfolgreicher „small talk“?
Ob geschäftlich oder privat – „small talk“ braucht wirklich jeder, und nichts ist unangenehmer als dazustehen und nicht zu wissen was man sagen soll!
Dr. Stephan Lermer im Interview mit Landeswelle Thüringen gibt hilfreiche Tipps:
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Landeswelle Thüringen, Beitrag vom 24.07.2009, Interview
Hot or not? Männer sind sich einig. Frauen nicht.
Einer neuen Studie des Psychologen Dustin Wood von der Wake Forest University in Winston-Salem nach, ist der Konsens unter Männern bei der Beurteilung von Attraktivität weitaus höher als der bei Frauen.
„Männer sind sich sehr stark darüber einig wen sie attraktiv finden und wen unattraktiv, Frauen hingegen denken differenzierter,“ so Wood. „In unserer Studie konnten wir diesen offensichtlichen Geschlechterunterschied erstmals objektiv zeigen“.
In ihrem Experiment bewerteten über 4000 Teilnehmer zwischen 18 und 70 Jahren die Attraktivität von Männern und Frauen auf Fotos im Alter zwischen 18 und 25 Jahren auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht attraktiv) bis 10 (sehr attraktiv).
Bevor die Teilnehmer die Attraktivität der Personen auf den Bilden einschätzten, wurden die Bilder erst einmal von dem Forscherteam selbst eingestuft, je nach dem wie verführerisch, selbstsicher, dünn, sensibel, modisch, kurvenreich (Frauen), muskulös (Männer), traditionell, männlich/weiblich, klassisch, gepflegt oder fröhlich die Personen aussahen. Dies half den Forschern als Marker, welche Merkmale einen besonderen Einfluss haben könnten.
Das Ergebnis: Die Urteile der Männer basierten größtenteils auf der physischen Attraktivität der Frauen: Am attraktivsten wurden vor allem Frauen mit einem schlanken, verführerischen Äußeren eingestuft. Eine kleine Überraschung fand man dennoch: Auch Frauen, die selbstsicher wirkten, wurden als attraktiver eingeschätzt.
Frauen zeigten zwar eine gewisse Tendenz für schlanke, muskulöse Männer, aber sie waren sich im Großen und Ganzen sehr uneinig darüber, wer attraktiv ist und wer nicht. Manche Frauen bewerteten Männer als sehr attraktiv, die zuvor von anderen Frauen als überhaupt nicht attraktiv bewertet wurden.
Die Studie habe wichtige Implikationen für die unterschiedlichen Strategien der Geschlechter bei der Partnersuche, so Wood. Seine Argumentation: Frauen werden mit weniger Wettbewerb um den Angebeteten konfrontiert werden, Männer hingegen müssen mehr Zeit und Energie in ihre Wunschpartnerin investieren, und sie dann noch vor anderen Interessenten bewachen.
„Die Studie zeigt außerdem, warum es für Frauen wichtiger ist, ihre physische Attraktivität aufrechtzuerhalten. Frauen, die Männer beeindrucken wollen, haben mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Erfolg, wenn sie gewisse physische Standards erfüllen. Obwohl auch Männer, die diesen Standards entsprechen, als attraktiver eingeschätzt werden – insgesamt ist ihre Bewertung nicht so stark an körperliche Merkmale gebunden,“ meint Dustin Wood.
Zeit für die Männer, ihr Attraktivitätsrating noch einmal zu überdenken: gibt es neben der physischen Attraktivität noch andere Vorzüge an potentiellen und realen Partnerinnen? Finden und loben Sie diese. Frauen fahren sehr erfolgreich mit dieser Strategie. Und geben zudem häufiger an, den ‚Richtigen‘ gefunden zu haben.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: www.wfu.edu/news/release/2009.06.25.a.php, Homepage der Wake Forest University
Darf ich Ihnen einen Drink spendieren?
Diamanten, steigende Kredit-Karten-Schulden, Auto-Notverkauf, Hypotheken und eine neue Midlife-Crisis-Corvette – das alles sind Anzeichen für „zwanghaftes Konsumieren“.
Der Psychologe Daniel Kruger von der University of Michigan sucht in der Evolutionsgeschichte bzw. der Paarung und Begattung nach einer Erklärung. Seine Theorie: Männer überziehen ihr Budget, um Frauen zu beeindrucken! Wie schon seit tausenden von Jahren läuft also im Endeffekt alles darauf hinaus, für möglichst viel Nachwuchs zu sorgen.
Kruger testete seine Hypothese an erwachsenen Männern und Frauen zwischen 18-45 und fand heraus, dass die finanziellen Ausgaben in direktem Bezug zu den zukünftigen Beziehungswünschen und zum vergangenen Paarungserfolg stand. Allerdings: Nur bei Männern!
Nach Kruger war der Umgang mit Geld der einzige Faktor, der zuverlässig vorhersagte, wie viele Partner sich Mann in den nächsten fünf Jahren wünschte und wie viele er in den letzten fünf Jahren tatsächlich hatte. Interessanter Weise führte eine Ehe der männlichen Teilnehmer nur innerhalb des ersten Ehejahres zu einer Reduktion der Partnerschaftswünsche auf genau einen Sexualpartner.
Die 25% der Männer mit den konservativsten Finanzstrategien hatten im Durchschnitt drei Partnerinnen in den letzten fünf Jahren und wünschten sich durchschnittlich auch nur eine Partnerin in den nächsten fünf Jahren. Bei den 2% der Männer mit den riskantesten Strategien verdoppelten sich die Werte auf sechs Verflossene und mindestens zwei gewünschte Partnerinnen.
„Früher wurden Männer daran gemessen, ob sie gute Ernährer waren. Heute haben wir eine neue Konsumkultur, in der wir unser Potenzial hauptsächlich durch unseren Besitz an Konsumgütern zeigen, anstatt ein guter Jäger zu sein oder Schutz zu gewähren,“ so Kruger.
„Das ist eine ultimative Erklärung dafür, dass wir immer das haben wollen, was andere haben. Unsere Position in der sozialen Hierarchie basiert auf unseren Ressourcen, insbesondere gilt das für Männer. Ökonomischer Erfolg war schon immer gut für den reproduktiven Erfolg eines Mannes, daher haben Männer einen besonderen Anreiz zu zeigen, dass sie wirtschaftlich gut positioniert sind.“
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Kruger, D. J. (2008): Male financial consumption is associated with higher mating intentions and mating success. Evolutionary Psychology, 6/4: pp. 603-612
„Sei mein Held – oder verliere alles.“ Aber ohne mich.
Risikoverhalten von Männern und Frauen unter Stress
„Der Gedanke, etwas nicht zu riskieren, ängstigt mich zu Tode.“ Der Spruch stammt von Kevin Kostner, den viele als ‚urmännlich‘ bezeichnen würden. Wir kennen ihn typischer Weise aus actiongeladenen, dramatischen Rollen. Mit dem Auge des Wissenschaftlers und Psychologen betrachtet würden wir ihm attestieren, dass er ständig unter Stress steht. Und dann Dinge wagt, die (meistens) Erfolg bringen.
In den allermeisten Fällen sind es auch in Filmen Männer, die unter Stress die unmöglichsten Risiken eingehen, während Frauen sich eher zurückhalten und mit großen Augen dem Helden vertrauen. Aber stimmt dieses Klischee auch?
In unserem Beitrag ‚Gender Matters‘ vom 30.6.09 berichteten wir über Ergebnisse aus den Neurowissenschaften, die zeigen, dass bei Männern und Frauen teilweise andere Gehirnareale aktiv werden, wenn sie unter Stress stehen. So werden bei Männern eher Regionen aktiv, die mit Kampf oder Flucht (also Verhaltensaktivierung) zu tun haben. Bei Frauen dagegen dominieren Regionen, die mit emotionaler Stressverarbeitung assoziiert sind.
Nichole Lighthall von der University of Southern California hat nun nachgewiesen, dass sich diese im Gehirn sichtbaren Aktivierungen auch auf das Verhalten auswirken. Sie setzte die Hälfte ihrer Teilnehmer akutem Stress aus, während die übrigen Frauen und Männer in einer lockeren Stimmung an ihrem Versuch teilnahmen.
Dort hatten dann alle die Aufgabe, Luftballons aufzublasen – virtuell, per Mausklick am PC. Je weiter sie die Ballons aufbliesen, desto mehr Geld konnten sie gewinnen. Das Risiko dabei: Die Ballons platzten bei unterschiedlichen Größen. Passierte das, verloren die Teilnehmer ihr Geld.
Und hier bestätigten sich das Klischee und die neuropsychologischen Befunde tatsächlich: Männer, die unter Stress standen, steigerten ihre Risikofreudigkeit um 20%, während bei Frauen die Risikofreudigkeit um fast 30% sank!
Nichole Lighthall erklärt das Ergebnis so: „Evolutionär gesehen ist es vielleicht nützlicher für Männer, in Stresssituationen, wenn es um alles oder nichts geht, aggressiv zu reagieren. Wir haben finanzielle Risiken untersucht, aber dort verhält es sich genauso wie bei modernen Revierkämpfen oder anderen wertvollen Ressourcen.“
Andererseits: „Es gibt offensichtlich Situationen, in denen Risikoverhalten schädlich ist. Manchmal ist es gewinn bringender, konservativ, rational und langsam zu reagieren.“
Diese gründliche, rationale Verarbeitung von Stress und Risikosituationen zeigt sich offensichtlich eher bei Frauen. Solche Situationen finden wir ganz häufig in wirtschaftlichen Krisensituationen, weshalb manche Autoren vorschlagen, in Wirtschaftskrisen mehr weibliche Manager zu beschäftigen und den Entscheidungsspielraum weiblicher Entscheider zu erhöhen (siehe unseren BLOG-Beitrag vom 12.3.2009)
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: University of Southern California (2009, July 1). Risky Business: Stressed Men, But Not Stressed Women, More Likely To Gamble And Takes Risks.
‚Gender matters‘: Unterschiedlicher Umgang von Frauen und Männern mit Stress zeigt sich im Gehirn
Forscher der University of Pennsylvania weisen mit neurophysiologischen Methoden nach, dass Frauen und Männer unterschiedlich auf Stress reagieren. Dies hat Folgen für die Behandlung von stressbedingten Erkrankungen wie Burnout, posttraumatische Stressbelastung und Depression.
Männer stammen vom Mars, Frauen von der Venus. Das ist wohl die einfachste Erklärung für die offensichtlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Einen wesentlich differenzierteren Einblick in die unterschiedlichen Erlebniswelten von weiblichen und männlichen Menschen von heute liefern moderne bildgebende Verfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT). Mit deren Hilfe kann belegt werden, dass Männer und Frauen wirklich teilweise sehr unterschiedlich reagieren.
Zum Beispiel unter Stress: Forscher der University of Pennsylvania überwachten mittels fMRT den Blutfluss im Gehirn ihrer Probanden, während sie sie künstlich Stress aussetzten. Die Teilnehmer wurden angewiesen, von 1600 in 13er-Schritten rückwärts zu zählen. Dabei reagierte der Versuchsleiter ärgerlich auf Fehler und wies sie ständig an, schneller zu zählen (siehe dieses Video).

Beim fMRT können Änderungen des Blutflusses in sämtlichen Hirnregionen mit relativ guter räumlicher Auflösung erfasst werden. Was bringt das? Einfach gesagt: Braucht eine bestimmte Hirnregion Blut, dann arbeitet sie. Zum Denken brauchen wir nämlich Nährstoffe, vor allem Sauerstoff und Zucker. Unser Gehirn ist für 90% des Sauerstoffverbrauches verantwortlich.
Das Ergebnis der Untersuchung: Männer wie Frauen berichteten, sie wären während des Zählens gestresst gewesen. Und zumindest äußerlich zeigten Sie auch dieselben Symptome (Sprache, Atmung, Herzratenanstieg, Cortisolanstieg). Allerdings wurden bei Männern und Frauen zum Teil andere Gehirnareale aktiv:
Bei Männern reagierte der rechte präfrontale Cortex stärker. Er ist Teil des sogenannten ‚Fight-or-Flight‘-Systems, das in Stresssituationen Verhaltensreflexe auslöst. Sprich: Entweder Kampf oder Flucht. Im Alltag werden diese automatischen Reflexe normaler Weise durch geselschaftliche Normen gehemmt. Im fMRT dadurch, dass man fixiert ist.
Bei Frauen dagegen war das limbische System aktiver – ein Verbund von Hirnregionen, die für das Aufkommen und die Verarbeitung von Emotionen eine wichtige Rolle spielt. Es zeigt sich also schon im Gehirn, dass Männer unter Stress eher aggressiv und fahrig reagieren, Frauen dagegen emotionaler. Deshalb kommen sie aber nicht automatisch von anderen Planeten.
Die unterschiedlichen Stressverarbeitungsstrategien sind zum Teil genetisch bedingt, zum Teil aber auch in Kindheit und Jugend gelernt.
Wir verfolgen diesen vielversprechenden neuen Forschungszweig mit großer Spannung. Durch die Aufdeckung neurophysiologischer Unterschiede bei der Stressverarbeitung in den Gehirnen von Männern und Frauen werden sich weitere interessante Strategien für den Umgang mit psychischen Belastungen ergeben.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Wang, J. (2007). Gender difference in neural response to psychological stress. Social cognitive an affective neuroscience, 2007, 2(3), pp. 227-239