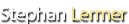Schönheit ist nicht immer von Vorteil
Debralee Lorenzano wurde aus ihrem Job bei einer angesehen New Yorker Bank gefeuert, weil sie zu hübsch ist – das behauptet sie jedenfalls. Es könnte sein, dass sie damit Recht hat. Zumindest haben es hübsche Menschen entgegen aller Vorurteile nicht immer leichter als graue Mäuse. Und ab und zu sogar schwerer.
Das belegt eine Studie der Münchner Psychologin Maria Agthe. Sie untersuchte das Verhalten von Chefs bei der Bewerberauswahl und entdeckte eine interessante Tatsache: Waren die Chefs selbst relativ attraktiv, so stellten sie Bewerber unabhängig von ihrem Aussehen ein. Waren die Chefs selbst allerdings eher unattraktiv, so hatten attraktive Bewerber gleichen Geschlechts weniger Chancen.
Die Forscherin vermutet, dass ein hübsches Gesicht eine Konkurrenz für den eigenen Status darstellt und deshalb eher abgelehnt wird. Männliche und weibliche Führungskräfte taten sich übrigens gleichermaßen schwer, hübsche Mitarbeiter einzustellen. Allerdings aber nicht, wenn die potentiellen KollegInnen anderen Geschlechts waren. Fazit: Ist die/der Personalverantwortliche anderen Geschlechts, dürfen Sie ihn/sie ruhig „beeindrucken“. Ist er/sie gleichen Geschlechts, verringern sich die eigenen Chancen, je attraktiver Sie wirken.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: managerseminare 9/2010
Die Gründerpersönlichkeit
Selbständigkeit ist in Deutschland keine Selbstverständlichkeit: Nur etwa 10,5% aller erwerbstätigen Deutschen sind selbständig. Vergleicht man diese Zahl mit dem Schnitt anderer Länder, so fragt man sich, wie die deutsche Gesellschaft aus der Gründermentalität der Nachkriegsjahre (durchschnittlich 30% Neugründungen in den 50er Jahren) in eine solche „unternehmerische Lethargie“ fallen konnte: Deutschland nimmt von 20 untersuchten Industrienationen gerade einmal den 15. Platz ein. Abgehängt zum Beispiel von der Schweiz, den Niederlanden oder Großbritannien.
Ganz zu schweigen von den USA. Und beim Vergleich mit dem transatlantischen „großen Bruder“ sieht man auch sehr schön, warum das so ist: „Hinfallen ist dort nicht schlimm, [in Deutschland] kommt es einer Katastrophe gleich“ analysiert Marie-Dorothee Burandt, Co-Autorin einer groß angelegten Studie des BDP (Berufsverband deutscher Psychologen und Psychologinnen).
Laut der Studie ist es die Angst vor dem Scheitern, das vielen potentiellen Gründern die Selbständigkeit verwehrt: „Wer in Deutschland als Selbständiger scheitert, steht nur schwer wieder auf. Das Bild, nichts zu taugen, es nicht geschafft zu haben, haftet an einem wie ein Makel.“ Unternehmensgründer sind in der Regel dadurch motiviert, etwas Neues zu leisten, sich durchzusetzen und sich von der Gesellschaft abzuheben. Wenn allerdings die Gesellschaft die Werte Freiheit, Durchsetzungsstärke und Unabhängigkeit nicht schätzt und Unternehmer immer häufiger mit Abzockern gleichgesetzt werden, will das schließlich keiner mehr ernsthaft anstreben.
Deshalb rät Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages: „Wir brauchen […] eine deutschlandweite Offensive für das Verständnis von Unternehmertum.“
Die Studie des BDP berichtet allerdings auch von positiven Aspekten: Von der idealen Gründerpersönlichkeit und von der „Ausbildung“ zum Unternehmensgründer durch Bildung und Training. Wird nächste Woche fortgesetzt.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: http://www.bdponline.de/web/newsletter/2010/05.html
Sonnenbrille ab, Fremder!
Das Tragen dunkler Gläser wirkt sich nicht positiv auf unsere Kommunikation aus. Das weiß Carolin Lüdemann, Etikette-Expertin und Mitglied im Deutschen Knigge-Rat. Denn: „Wer den Kommunikationspartner seine Augen nicht sehen lässt, erzeugt den Eindruck, als hätte er was zu verbergen.“
Ein Experiment von Psychologen der Universität von Toronto zeigt recht schön, warum wir nicht so gut mit Menschen können, die Sonnenbrillen tragen: Sie ließen Studenten eine Serie von Planspielen durchführen, in den sie mit anderen kooperieren und so das Wohl aller Mitspieler fördern. Sie konnten allerdings auch egoistische Strategien fahren und nur ihr eigenes Wohl maximieren.
In einer Bedingung des Experiments hatten die Studenten Sonnenbrillen auf, während sie in der anderen Bedingung sonnenbrillenlos spielten. Und siehe da: Mit Sonnenbrille verhielten sich die Teilnehmer wesentlich egoistischer.
Die Forscher nehmen an, dass uns Sonnenbrillen ein Gefühl der Anonymität verschaffen. Diese Anonymität führt dazu, dass wir uns weniger identifizierbar fühlen und damit auch weniger angreifbar, falls wir einmal etwas tun, das von unseren Mitmenschen nur schwer akzeptiert werden würde. Erhöhter Egoismus trat übrigens auch dann auf, wenn die Teilnehmer in abgedunkelten Räumen spielten. Und: Die Teilnehmer mit Sonnenbrillen wurden auch als egoistischer und rücksichtsloser von ihren Mitspielern wahrgenommen.
Unabhängig von diesen erhellenden Experimenten gilt aber, dass unsere Augen sehr viel über uns verraten. Logisch, dass wir ihnenunseren Mitmenschen gerade deshalb in die Augen schauen wollen. Wir wollen wissen: Freund oder Feind, Wohltäter oder Übeltäter, interessiert oder nicht? Und sobald jemand seine Augen vor uns verbirgt, werden wir unsicher und vorsichtig. Deshalb rät Lüdemann: In geschlossenen Räumen gehört die Sonnenbrille abgesetzt. Neben dem UV-Schutz ist sie zwar zugebenermaßen ein hübsches Accessoire. Allerdings: Wir können uns damit durchaus auch Eigentore schießen.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: http://www.world-science.net
Blind vor Eifersucht
Mit einem simplen, aber genialen Experiment haben Forscher der University of Delaware gezeigt, dass Eifersucht im wahrsten Sinne des Wortes blind macht:
Sie baten Paare ins Versuchslabor. Während sich die Partner gegenübersaßen, bekamen sie auf je einem eigenen Bildschirm Bilder präsentiert. SIE hatte die Aufgabe, unter schnell wechselnden Bildern auf ihrem Schirm solche zu notieren, die Landschaften darstellen. ER sollte Landschaften auf ihre Schönheit hin beurteilen.
Bei der Hälfte des Experiments dann der entscheidende Punkt: Die Versuchsleiter teilten IHR mit, das ER von jetzt an die Attraktivität von Single-Frauen bewerten würde. In Wahrheit machte ER einfach mit den Landschaften weiter – eine Situation also, die der Realität sehr nahe kommt 😉
Daraufhin nahm die Entdeckungsleistung der untersuchten Frauen enorm ab. Grund dafür sind immer wiederkehrende Gedanken und mentale Bilder über die „Aufgabe“ des Partners und die potentiellen Folgen, die damit verbunden sein könnten. Diese Gedanken und Bilder beherrschten die Aufmerksamkeit der Frauen so gründlich, dass sie für manche Reize in der Umgebung schlichtweg blind wurden.
Derzeit werten die Forscher die Daten der Männer aus, deren Partnerinnen attraktive Männer beurteilen durften. Man darf gespannt sein….
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: University of Delaware (2010, April 14). Blinded by jealousy?. ScienceDaily. Retrieved July 23, 2010, from http://www.sciencedaily.com /releases/2010/04/100413160859.htm
Kausalattribution – Glück und Unglück durch Ursachenzuschreibung
Warum schaffen es manche Menschen, nachhaltig von Erfolgen zu zehren, während bei anderen das Glück immer nur von kurzer Dauer ist? Wieso geht für manche bereits bei kleinen persönlichen Misserfolgen die Welt unter, während manche die berühmten „twists and turns“ im Leben lässig mit einem Schulterzucken abtun? Warum machen es sich manche Leute so unglaublich schwer, obwohl doch ihr Leben größtenteils von Glück bestimmt ist?
Die Herren Rotter, Seligman und Weiner helfen uns bei diesen Fragen weiter. Sie gehörten verschiedenen Forschergruppen an, die sich ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem Phänomen der „Kausalattribution“ (deutsch: Ursachenzuschreibung) beschäftigten. Damit gingen sie zwei wichtigen Frage nach: 1. Wen oder was kann man für Erfolg und Misserfolg verantwortlich machen? und 2. Macht es einen Unterschied, wen oder was wir verantwortlich machen?
Zur Beantwortung der Fragen benutzen wir Otto Normalverkäufer. Herr Normalverkäufer hat gerade erfahren, dass er im letzten Quartal die höchste Abschlussquote aller 17 Verkäufer erreicht hat und eine satte Prämie kassiert. Er kann nun Stolz empfinden und sich selbst sagen, dass er ja immer wusste, dass er der beste Verkäufer sei. Oder er kann Schuld empfinden und die hohe Abschlussquote auf strukturelle Bedingungen in seiner Region zurückführen – zum Beispiel die Öffnung eines Neubaugebietes und damit den Zuzug vieler potentieller Neukunden, die seine Arbeit „erleichtert“ haben.
Herr Normalverbraucher kann also entweder „internal“ attribuieren („ich bin eben der beste“) oder „external“ („die Bedingungen waren eben gut“). Rotter, Seligman und Weiner würden ihm zur internalen Attribution raten: Bei Erfolgen führt eine internale Ursachenzuschreibung zu langfristiger Zufriedenheit. Bei Misserfolgen ist es genau anders herum: internale Zuschreibung führt dazu, dass wir längerfristig schlecht von uns denken – definitiv ein „Glückskiller“. Externale Zuschreibung dagegen lässt uns die schlimmen Dinge leichter nehmen – „es war halt Pech, beim nächsten Mal wird es wieder besser“.
Es macht also sehr wohl einen Unterschied, wen oder was wir für unsere (Miss-)Erfolge verantwortlich machen. Interessant dabei: Dieser Urteilsbildungsprozess läuft zunächst unbewusst ab. Herr Normalverkäufer bekommt also auf Grund der unbewussten Urteilsbildung erst einmal ein gutes oder schlechtes Gefühl. Dieses Gefühl motiviert ihn, anschließend Erklärungen für seine Stimmung zu suchen. Kennt man nun dieses Prinzip, kann man die eigene Stimmung mit einiger Übung zum Teil nachträglich und nachhaltig beeinflussen.
Das heißt nicht, dass man zum „Berufsoptimisten“ werden soll oder zur Nervensäge, die noch am Weltuntergang irgendetwas Schönes findet. Aber es hilft oft, dem Schlechten den Schrecken zu nehmen und Selbstwertgefühl aufzubauen. „Jeder ist seines Glückes Schmied“ – für wenige Dinge gilt dieses Sprichwort so sehr wie für die Kausalattribution von persönlichen Erfolgen und Misserfolgen.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Richtige Entscheidung? Zweifel? Einfach fortspülen!
Partnerwahl, Autokauf, Urlaubssuche, Börsenkurse – täglich haben wir die Qual der Wahl. Und oft genug haben wir ein mulmiges Gefühl, nachdem wir eine Entscheidung getroffen haben. Dieses Gefühl hat einen wissenschaftlichen Namen: ‚Kognitive Dissonanz‘ (Wir berichteten im Beitrag vom 1. Juli 2009). Es entsteht immer dann, wenn wir uns zwischen mehreren im Prinzip gleichwertigen Alternativen entschieden haben und kann sehr unangenehm sein.
Forscher der University of Michigan berichten nun von einem sehr einfachen ‚Rezept‘, um Kognitive Dissonanz teilweise zu reduzieren. Spike Lee und Norbert Schwarz fanden in ihrem Experiment, dass Händewaschen Zweifel beseitigen kann.
Lee behauptet, dass Händewaschen ’sowohl von unmoralischem Verhalten befreit, als auch von Gedanken über schwierige Entscheidungen. Zahlreiche Experimente hatten belegt, dass sich Menschen nach unmoralischen Handlungen weniger schlecht fühlen, wenn sie sich waschen – wie Shakespeare’s Lady MacBeth nach dem Mord an König Duncan. Lee schreibt dem Händewaschen deshalb eine besondere emotionale Bedeutung zu: Gefühle werden duch das Reinigen eliminiert oder zumindest abgeschwächt. Ein Grund warum Sportler ihre ‚Meisterschaftssocken‘ nicht waschen und Teenies nicht die Hände, mit denen sie Ihren ‚Star‘ berührt haben: Die positiven Gefühle sollen länger anhalten.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: Lee, S. Science, May 7, 2010; vol 328.