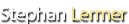Emotionale Intelligenz: Die Fähigkeit Emotionen zu erkennen beeinflusst das Jahresgehalt
Emotionale Intelligenz, die Fähigkeit, eigene und fremde Emotionen erkennen und sie unterscheiden zu können, ist in den letzten Jahren in den Fokus der psychologischen Forschung gerückt. Es geht darum diese Informationen zu nutzen, um das eigene Denken und Handeln zu lenken. Emotionale Intelligenz gilt als wichtige Schlüsselkompetenz, um im Privatleben, in der Schule und im Beruf erfolgreich sein zu können. Eine neue Studie ermittelte nun sogar einen Zusammenhang mit dem Jahresgehalt.
Wer emotional intelligent ist und so Gefühle, Stimmungen, Leidenschaften und ähnliche emotionale Zustände an sich selbst und anderen richtig erkennt, kann diese Informationen nutzen und damit erfolgreicher im Privat- und Berufsleben sein. Die Ergebnisse einer Studie von Jochen Menges, Professor an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf, gehen noch darüber hinaus: Die Forscher stellten fest, dass sich die Emotionserkennungsfähigkeit auf das Einkommen auswirkt.
Emotionale Intelligenz
John D. Mayer von der University of New Hampshire und Peter Salovey von der Yale University, Begründer der Forschung zu Emotionaler Intelligenz, beschreiben diese als die Fähigkeit, Emotionen an sich selbst und anderen korrekt erkennen und unterscheiden zu können und dies als Informationen nutzen zu können, die das eigene Denken und Handeln lenken. Intelligenz geht also, ihrer Ansicht nach, weit über den klassisch akademischen Intelligenzbegriff hinaus und umfasst nicht nur verbale und numerische Fähigkeiten. Um beruflich und privat erfolgreich sein zu können, reicht es also nicht, in der Schule gute Aufsätze zu schreiben und mathematische Zusammenhänge zu erkennen. Vielmehr seien es Fähigkeiten, die helfen Emotionen zu erkennen und zu beeinflussen, die zu Lebenserfolg nachhaltig beitragen.
Emotionale Intelligenz umfasst somit die Fähigkeit, eigene Emotionen richtig zu erkennen und sie so zu handhaben, dass sie der Situation angemessen sind und helfen, die eigenen Ziele zu erreichen. Empathie, also die Fähigkeit, Emotionen an anderen zu erkennen und mit diesen angemessen umgehen zu können, wird ebenfalls der Emotionalen Intelligenz zugezählt.
Emotionserkennung als ökonomischer Erfolgsfaktor
Mit ihrer Studie konnten Forscher nun die These von Mayer und Salovey bestätigen, denn Emotionserkennung, ein Teilaspekt der Emotionalen Intelligenz, erhöht nicht nur den allgemeinen Lebenserfolg, sondern auch den finanziellen: Sie fanden einen direkten Zusammenhang zwischen der Emotionserkennungsfähigkeit und der Höhe des Jahresgehalts. Mitarbeiter, die Gefühle von anderen besser erkennen konnten, hatten verdienten deutlich besser als ihre Kollegen, die diese Fähigkeit nicht oder nur in geringem Maße aufwiesen. Andere Faktoren wie akademische Intelligenz, Gewissenhaftigkeit, Geschlecht, Alter, Ausbildung, Wochenarbeitszeit und hierarchische Position im Unternehmen wurden in die Untersuchung miteinbezogen, doch auch unter Berücksichtigung dieser Variablen blieb der Zusammenhang zwischen Emotionserkennungsfähigkeit und Jahresgehalt bestehen. Diese Fähigkeit ist also nicht nur von zwischenmenschlicher Bedeutung, sondern hat auch einen deutlichen ökonomischen Wert.
Euphorie – mit Vorsicht
Sicherlich sind diese Ergebnisse erstaunlich und machen deutlich, wie wichtig Emotionale Intelligenz für Lebenserfolg ist. Menschen mit guter Emotionserkennung verhalten sich geschickter in sozialen Kontexten und werden als kooperativer, rücksichtsvoller und hilfreicher eingeschätzt.
Dennoch beinhaltet diese Form der Intelligenz auch die Fähigkeit zur Beeinflussung der Gefühle anderer. Dies kann zum Positiven geschehen, aber auch bedeuten, dass gezielt positive Emotionen geweckt werden, damit Mitarbeiter immer mehr leisten oder Kunden immer bereitwilliger kaufen. Diese Form der manipulativen Beeinflussung, die lediglich einseitig dem Erreichen der Unternehmensziele dient, ist sicher nicht im Sinne der Begründer der Forschung zu Emotionaler Intelligenz.
Emotionale Intelligenz geht weit über die akademische Bildung hinaus. Sie hilft, in sozialen Kontexten erfolgreich zu sein und trägt damit deutlich zum allgemeinen Lebenserfolg bei. Es ist abzusehen, dass ihr dank ihrer Funktion als Wirtschaftsfaktor in Zukunft in der Personalführung und auch in Bildungseinrichtungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden wird.
Quellen:
Goleman, D. (1996). Emotional Intelligence. Why It Can Matter More than IQ. Learning, 24(6), 49-50.
Menges, J., & Ebersbach, L. (2008). Die Bedeutung von Emotionen und emotionalem Kapital im internen und externen Unternehmenskontext. Eine Mentalitätsgeschichte der deutschen Industriegesellschaft am Beispiel des rheinischen Dormagen (1917-1997), Essen, 21-44.
Momm, T., Blickle, G., Liu, Y., Wihler, A., Kholin, M., & Menges, J. I. (2015). It pays to have an eye for emotions: Emotion recognition ability indirectly predicts annual income. Journal of Organizational Behavior, 36(1), 147-163.
Arbeitsweg und Wohlbefinden: Wer täglich pendelt, ist unzufriedener
Je länger der tägliche Arbeitsweg, desto niedriger die Lebenszufriedenheit. Diesen einfachen, aber doch erstaunlichen Zusammenhang deckten kanadische Forscher kürzlich auf. Sie untersuchten die Gründe dieses Phänomens und bieten Lösungen an.
Wer in den letzten Wochen und Monaten – gestresst durch die immer wiederkehrenden Streiks im öffentlichen Nahverkehr – versucht war, zukünftig dauerhaft auf das eigene Auto als Transportmittel zur Arbeit umzusteigen, dem raten Margo Hilbrecht, Bryan Smale und Steven E. Mock (Forscher an der Universität Waterloo, Kanada) davon ab. Denn sie entdeckten einen direkten Zusammenhang zwischen der Länge des Arbeitswegs und der allgemeinen Lebenszufriedenheit: Je länger man für den Weg zwischen Arbeit und Zuhause benötige, desto unzufriedener werde man im Allgemeinen.
Wie sich der tägliche Arbeitsweg auf das Wohlbefinden auswirkt
Die Forscher werteten eine Umfrage der kanadischen Regierung unter mehr als 3.000 Menschen aus, die täglich mit dem Auto zur Arbeit fahren. Sie untersuchten deren Zeitverwendungsmuster plus ihr Wohlbefinden. Um einen möglichen Zusammenhang zu untersuchen legten sie das sog. „Resource Drain Model“ zugrunde. Dieses ursprünglich aus der Beruf-Familien-Forschung stammende Konfliktmodell postuliert, dass Veränderungen in einem Tätigkeitsbereich andere negativ beeinflusst. „Resource Drain“, also der Abfluss von eigenen Möglichkeiten entsteht dann, wenn – beabsichtigt oder nicht – Ressourcen wie Zeit, Energie oder Aufmerksamkeit für einen Tätigkeitsbereich so stark verwendet werden, dass für andere keine oder zu wenige bleiben. Leistet man also ständig Überstunden, wird man kaum mehr Zeit mit Familie oder Freunden verbringen können. Abhängig von persönlichen Präferenzen, biologischen Bedürfnissen, sozialen Rollen und damit verbundenen Verpflichtungen beeinflusst also die Verwendung der eigenen Ressourcen die Lebenszufriedenheit.
Die Forscher wählten für ihre Analyse solche Aktivitäten aus, die mit Wohlbefinden assoziiert sind und werteten die Antworten der Studienteilnehmer auf Fragen nach deren alltäglichen Zeitdruck aus; und wie zufrieden sie allgemein mit ihrem Leben waren. Werte für das allgemeine Wohlbefinden wurden aus diesen Themenbereichen ermittelt.
Das Ergebnis dieser Auswertung ist bemerkenswert: Pendler mit längeren Anfahrtswegen bewerteten ihre Lebenszufriedenheit signifikant geringer und gaben an, unter höherem Zeitdruck zu stehen.
Das „Resource Drain Model“ erklärt diesen Zusammenhang so: Wer lange Anfahrtswege in Kauf nehmen muss, hat weniger Freizeit, was sich unmittelbar auf das eigene Wohlbefinden auswirkt.
Stress, Zeitdruck, Routine und die Folgen
Die Zeit, die täglich im Auto verbracht wird, wird von den meisten als sehr stressig empfunden. Stau und stockender Verkehr erhöhen den Zeitdruck und führen zu Frustration. Das hat langfristig sogar negative Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit: Wie eine schwedische Studie ergeben hat, leiden Pendler häufiger unter Bluthochdruck, Übergewicht, geringerer kardiovaskulärer Fitness, Stress, Abgeschlagenheit und haben tatsächlich höhere Fehlzeiten.
Außerdem bedeutet mehr Zeit im Auto zwangsläufig weniger Zeit für andere Tätigkeiten. Wichtige Aktivitäten, die das Wohlbefinden steigern könnten, wie Zeit mit der Familie und Freunden verbringen oder Sport treiben, bleiben somit auf der Strecke.
Lösungen für Pendler
Fahrradfahrer und Fußgänger kommen meist entspannter an ihrem Arbeitsplatz an als Autofahrer. Das hat eine weitere Studie in diesem Zusammenhang ergeben. Sicher ist dies nicht für alle Pendler möglich. Daher empfehlen die kanadischen Forscher Arbeitnehmern, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und vor allem, physische Aktivitäten in die tägliche Routine einzuplanen, da diese Stress lindern können. Arbeitgebern empfehlen sie, flexible Arbeitszeiten zu ermöglichen und Gelegenheiten zu bieten, körperliche Ausgleichs-Aktivität schon während der Arbeit auszuüben.
Wer täglich auf das eigene Auto angewiesen ist und lange Anfahrtswege hat, strapaziert seine physische und psychische Gesundheit. Wer jedoch einen Arbeitsplatz in der Nähe seines Zuhauses hat und sich regelmäßig körperlich betätigt, steigert seine Lebenszufriedenheit und letztlich sein persönliches Glück.
Quellen:
Hansson, E., Mattisson, K., Björk, J., Östergren, P.-O., & Jakobsson, K. (2011). Relationship between commuting and health outcomes in a cross-sectional population survey in southern Sweden. BMC Public Health, 11, 834. doi:10.1186/1471-2458-11-834
Hilbrecht, M., Smale, B., & Mock, S. E. (2014). Highway to health? Commute time and well-being among Canadian adults. World Leisure Journal, 56(2), 151-163.
Turcotte, M. (2011). Commuting to work: Results of the 2010 General Social Survey. Canadian Social Trends, 92.
ADHS – Krankheit oder Erfindung?
Die Zahl der ADHS-Diagnosen steigt ständig und nimmt alarmierende Ausmaße an. Besonders häufig wird ADHS bei Kindern diagnostiziert, denen dann durch die Gabe von Ritalin geholfen werden soll, sich zu konzentrieren. Mehrere Wissenschaftler kritisieren diese Praxis jedoch scharf. Einige gehen so weit zu behaupten, die vermeintliche Krankheit sei reine Erfindung.
Laut einer Studie von 2007 wird weltweit bei etwa 5,3% aller Kinder ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung) diagnostiziert, Jungen sind ca. 4-mal häufiger betroffen als Mädchen. Die Krankheit beginnt in der Kindheit, setzt sich im Jugendalter fort und ist bei ca. 60% der Betroffenen auch noch im Erwachsenenalter bis in die Seniorenzeit nachweisbar. Sie macht sich durch Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität und Impulsivität bemerkbar und führt zu erkennbar bedeutsamen Beeinträchtigungen der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit. Um Betroffenen zu helfen, wird ihnen oft der Wirkstoffs Methylphenidat (Ritalin) verschrieben, der die Wiederaufnahme des Neurotransmitters Dopamin hemmt und sich persönlichkeitsverändernd auswirkt. Dies hat gerade in den frühen Lebensjahren gravierende Auswirkungen: Medikamente, die diesen Wirkstoff erhalten, machen abhängig, haben starke körperliche und psychische Nebenwirkungen und erfordern eine immer höhere Dosis, da die körpereigene Produktion von Neurotransmittern lahmgelegt wird.
Seit einigen Jahren wird die schnelle Verschreibung von Ritalin daher stark kritisiert. Nun aber gehen mehrere Wissenschaftler – unter ihnen auch der Entdecker des ADHS – sogar darüber hinaus, indem sie die Erkrankung als schiere Erfindung bezeichnen.
Fehldiagnose ADHS?
„ADHD does not exist“ – so lautet der kontroverse Titel des Buches des US-amerikanischen Neurologen Dr. Richard Saul. Er begründet seine These vor allem damit, dass die Diagnosekriterien für ADHS lediglich eine Sammlung von Symptomen seien, die völlig verschiedene Ursachen haben können. Fast immer seien es psychosoziale Ursachen, die für die Symptome verantwortlichen sind.
Sogar der Entdecker des ADHS, Leon Eisenberg, war dieser Meinung und stellte dies im letzten Interview vor seinem Tod im Jahre 2009 klar. Zum Einen seien die Symptome völlig ungenau, subjektiv und unspezifisch. Denn wer habe nicht hin und wieder „Schwierigkeiten mit der Organisation“, eine „Tendenz, Dinge zu verlieren“, wer ist nicht manchmal „vergesslich oder abgelenkt“ oder „achtet nicht genau auf Details“? Viel zu schnell werde die Diagnose ADHS vergeben und Ritalin verschrieben – nach der zugrundeliegenden Ursache werde nicht weiter geforscht.
Dies ergab auch eine Studie der medizinischen Forscher Rae Thomas, Geoffrey Mitchell und Laura Batstra, die zwar ADHS als Krankheit nicht leugnen, aber dennoch sehr viel genauere Diagnosekriterien verlangen, um Fehldiagnosen zu vermeiden.
Die Fragen Betroffener
Menschen, denen eine ADHS-Diagnose gestellt wurde, reagieren verständlicherweise oft empört auf die Behauptung, ihre Erkrankung existiere gar nicht. Schließlich hilft Ritalin vielen von ihnen, ihr Leben zu organisieren, sich zu konzentrieren und überhaupt erst leistungsfähig zu sein.
Doch ADHS-Kritiker leugnen nicht die Symptome an sich, sondern weisen darauf hin, dass sie andere als neurologische Ursachen haben. Psychosoziale Belastungsfaktoren, die dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Krankheit bis ins Erwachsenenalter persistiert, könnten die wahren Ursachen für das Auftreten der Symptome sein. Diese können aber natürlich nicht mit Medikamenten „geheilt“ werden.
Die Kritik daran, dass ADHS häufig schnell und anhand subjektiver Kriterien diagnostiziert wird, muss in jedem Fall ernst genommen werden. Gerade Eltern betroffener Kinder hilft es, sich genauer mit dem Thema auseinander zu setzen. Kindern Medikamente zu geben, nur weil sie für den Geschmack des ein oder anderen Lehrers zu unruhig sind, ist sicher keine gute Lösung. Denn manchmal können die Symptome auch für sehr positive Seiten stehen: Begeisterungsfähigkeit, Energie, Offenheit für Neues, Kreativität, große Begabung zum Multitasking und Improvisationstalent.
Quellen:
Thomas, R., Mitchell, G. K., & Batstra, L. (2013). Attention-deficit/hyperactivity disorder: are we helping or harming? BMJ, 347, f6172.
Polanczyk, G., de Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J., & Rohde, L. A. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. The American journal of psychiatry, 164(6), 942-948.
Saul, R. (2014). ADHD does not exist. Harper Collins.
Interview Leon Eisenberg:
Hedonische Anpassung verhindern: Der Weg zu langfristigem Glück
Das Glücksempfinden, das von bestimmten Erfolgen oder Schicksalswendungen herrührt, klingt mit der Zeit ab: positive Emotionen, die durch diese Veränderungen entstehen, nehmen ab, es entsteht ein Streben nach immer weiteren, größeren Erfolgen und mehr Glück. Das aber führt dazu, dass viele Menschen langfristiges Glück gar nicht erst verspüren können. Psychologen haben ein Modell erarbeitet, mit dessen Hilfe diese Entwicklung aufgehalten werden kann.
Mit Gedanken wie: „Wenn nur erst … geschehen wird, dann werde ich wirklich glücklich sein“, jagen viele ständig dem einen Ereignis nach, das sie vermeintlich glücklich machen wird. Sei es für Kinder dieses eine, ganz bestimmte Geburtstagsgeschenk, nach dem sie sich sehnen, oder für Erwachsene die nächste Beförderung, auf die sie lange hinarbeiten. Beim Eintreten dieses Ereignisses fühlen sie sich dann wirklich glücklich – leider oft nur vorübergehend. Nach kurzer Zeit wenden die meisten erneut viel Zeit und Energie auf, um dem nächsten Ereignis zuzustreben. Die wissenschaftliche Bezeichnung dieses Phänomens lautet „hedonische Anpassung“. Wissenschaftler der Universitäten in Missouri und Kalifornien sind diesem auf den Grund gegangen und haben Wege entdeckt, diesem immerwährenden Streben nach Mehr Einhalt zu gebieten.
Das Phänomen der hedonischen Anpassung
Mit jeder positiven Veränderung, ob nun ein neues Auto, ein originelles Spielzeug oder eine Gehaltserhöhung, erfahren wir eine Zunahme unseres Glücksempfindens. Diese Zunahme wird allerdings nur kurzfristig erlebt. Bald rutscht das Selbstgefühl in die Ausgangssituation und man ist wieder ebenso glücklich (oder auch unglücklich) wie zuvor. Die Beobachtung dieses Kreislaufs, der als hedonische Anpassung bezeichnet wird, trägt zur Klärung der Frage bei, warum es so schwierig erscheint, wirklich glücklich zu sein. Noch interessanter ist jedoch die Umkehrung der Fragestellung: Geht man der Frage nach, warum Menschen nicht so glücklich sind, wie sie es eigentlich erwarten, erhält man Aufschluss darüber, was dabei helfen kann, das Leben wirklich zu genießen. Sonja Lyubomirsky, Professorin für Psychologie an der Universität von Kalifornien, untersuchte dieses Phänomen und entwickelte gemeinsam mit Kollegen der Universität von Missouri ein Modell, mit dem das Empfinden langfristigen Glücks möglich ist.
Die Lösung erscheint zunächst recht einfach und nicht sehr originell: Das Erleben von positiven Emotionen und Ereignissen verlangsamt die hedonische Anpassung. Allerdings sind diese Emotionen und Ereignisse umso wirksamer, wenn sie im richtigen Kontext erlebt werden.
Positive Emotionen erleben
Gute Taten wie Geldspenden an Bedürftige lassen uns Glück erleben. Diese Taten sind aber nicht auf monetäre Spenden beschränkt. Vielmehr sind es oft kleine, alltägliche Dinge, die wir für unsere Mitmenschen tun können, die helfen, selbst mehr Glück zu empfinden.
Intrinsische Ziele zu setzen und erreichen ist ein weiterer Weg zum Glück. Die Ziele, denen wir entgegenstreben, sollten nicht von äußeren Faktoren wie Einkommen oder Anerkennung von anderen motiviert sein. Sie sollten statt dessen von innen kommen: Neugier, Interesse oder Selbstachtung sind Faktoren, die zum Glücklichsein führen können.
Anspruchsdenken in Schach halten. Je mehr wir erreichen, desto höher wird unser Anspruchsdenken. Das bedeutet aber, dass Dinge, die uns früher glücklich machten, es heute nicht mehr vermögen. Statt immer mehr erreichen zu wollen und somit Gedanken und Energie auf dieses „Endprodukt“, z.B. eine noch höhere Jahresprämie als in den Jahren zuvor, gerichtet zu halten, empfehlen Lyubomirsky und Kollegen, sich auf die Zeit vor der erlebten positiven Veränderung zurück zu besinnen. Zudem helfen auch hierbei intrinsische Ziele: Wer seiner Arbeit nachgeht, weil er/sie sie gern tut, wird jeden Bonus als unerwartete, zusätzliche Belohnung empfinden.
Wertschätzung für die positiven Dinge im Leben ist für das Glücksempfinden von essentieller Bedeutung. Viele sehen positive Ereignisse oder Schicksalswendungen für selbstverständlich an. Doch das sind sie nicht. Erst wer lernt, die vielen guten Ereignisse wertzuschätzen, die einem widerfahren, ist auf dem Weg zum Glück.
Abwechslung erleben. Konsistenz und Konsequenz sind wichtige Faktoren, um etwas erreichen zu können. Dennoch empfinden wir auch bei Tätigkeiten, die immer wieder ausgeführt werden müssen, Abwechslung als Bereicherung, die das Leben vielfältiger macht. Lyubomirsky und Kollegen empfehlen z.B. mehrere Projekte gleichzeitig zu verfolgen oder die Art, wie man eine bestimmte, wiederkehrende Aufgabe erfüllt, zu variieren.
Der Weg zum Glück ist kostenlos / The best things in life are free
Keine der von Lyubomirsky und Kollegen empfohlenen Strategien haben Gehaltserhöhungen oder materielle Besitztümer zum Gegenstand. Der Weg zum Glück kostet also kein Geld. Das Umdenken und das Ändern von Verhaltensweisen kann allerdings Mühe kosten. Der Lohn dafür ist dennoch unbezahlbar.
Quellen:
Lyubomirsky, S. (2008). The how of happiness: A New Approach to Getting the Life You Want. The Penguin Press: New York.
Sheldon, K. M. & Lyubomirsky, S. (2012). The Challenge of Staying Happier Testing the Hedonic Adaptation Prevention Model. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(5), 670-680.
Dr. Lermer in der Presse am „Internationalen Tag des Glücks 2015“
Dr. Lermer im Interview mit der tz:
Kriminalität und Terroranschläge: Glückliche Paarbeziehungen helfen, der Angst zu begegnen
Die Nachrichten über neue Terroranschläge versetzen die Welt in Angst und Schrecken. Seit Jahren untersuchen Psychologen Faktoren, die helfen, mit Bedrohungen umzugehen. Einer dieser Faktoren ist eine glückliche romantische Beziehung.
Nach den Terroranschlägen in Paris wächst die Angst vor weiteren Anschlägen und Kriminalität. Bedrohungsgefühle machen sich breit, sie führen zum Wunsch nach mehr Sicherheit, aber auch zu Vorurteilen und Hass. Das Gefühl der Machtlosigkeit und die Angst vor drohendem Unheil müssen aber – trotz dieser Geschehnisse – nicht unser Leben bestimmen. Sozialpsychologische Studien ermittelten Bewältigungsmechanismen, durch die diese Angst reduziert werden kann.
„Kulturelle Angstpuffer“
Seit fast zwanzig Jahren befassen sich Sozialpsychologen mit typischen Reaktionsmustern, die Menschen entwickeln, um mit Todesangst und dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit umzugehen. Die Terror-Management-Theorie von S. Solomon, J. Greenberg und T. Pyszczynski postuliert zwei Faktoren, durch die das Bewusstwerden der eigenen Sterblichkeit und die dadurch entstehende lähmende Angst besiegt werden kann:
Zum einen schaffen soziale Normen, höherer Sinn oder Transzendenz – kurz: die kulturelle Weltanschauung – eine Struktur und Wertestandards, die uns ein Gefühl von Sicherheit geben.
Der Glaube an diese kulturellen Wertestandards und die entsprechende Lebensführung können zum zweiten, dem emotionalen Faktor der Selbsterhaltung führen: dem eigenen Selbstwert.
Glückliche Paarbeziehungen als weitere „Angstpuffer“
Eine neuere Studie der israelischen Psychologen V. Florian, M. Mikulincer und G. Hirschberger erweitert die Terror-Management-Theorie um einen weiteren Faktor: Sie entdeckten die Angst reduzierende Wirkung romantischer Beziehungen.
Zum einen stellten sie fest, dass das Bewusstwerden der eigenen Sterblichkeit dazu führt, dass auch die Bindung zum/zur eigenen PartnerIn als enger empfunden wird. Andererseits reduzierten Gedanken an die enge Bindung zum/zur PartnerIn die Angst vor dem Tod. Außerdem stellten die Wissenschaftler fest, dass durch das Nachdenken über Partnerschaftsprobleme Gedanken an den Tod bewusster werden als das Nachdeken über z.B. akademische Probleme.
Eine innige und glückliche Partnerschaft hat also eine schützende Wirkung gegen existentielle Ängste.
Freiheit findet im Kopf statt
Der schweizer Autor Bernhard Steiner sagte: „Freiheit findet zur Hauptsache in unserem Kopf statt.“ Nach dem Lesen der obigen Studie möchte man dieses Zitat ergänzen: „und im Herzen“.
Quellen:
Pyszczynski, T., Greenberg, J., & Solomon, S. (1999). A dual-process model of defense against conscious and unconscious death-related thoughts: An extension of terror management theory. Psychological Review, 106, 835–845.
Florian, V., Mikulincer, M., & Hirschberger, G. (2002). The anxiety-buffering function of close relationships: evidence that relationship commitment acts as a terror management mechanism. Journal of personality and social psychology, 82(4), 527.