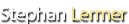Ausgepowert
Kommen Sie öfter von einem geistig anstrengenden Arbeitstag nach Hause und haben überhaupt keine Lust mehr auf Bewegung? Und das obwohl Sie am morgen motiviert und fest entschlossen waren, heute abend noch eine oder zwei Übungseinheiten im Studio zu absolvieren? Oder haben Sie sich jemals vorgenommen, nach den Zahlen der letzten Woche und den fälligen Telefongesprächen noch joggen zu gehen, nur um festzustellen, dass Sie danach einfach keine Lust mehr darauf haben?
Wir haben nicht unendlich Willenskraft zur Verfügung. Genauer gesagt ist unsere Willenskraft eine begrenzte Ressource, die irgendwann leer ist – wie ein Akku.
Das belegt eine Studie der Psychologin Kathleen Martin Ginis von der McMasters University in Kanada. Sie ließ ihre Versuchspersonen wiederholt den sogenannten ‚Stroop-Test‘ über längere Zeit bearbeiten. Eine faszinierende und witzige, aber gleichzeitig kognitiv fordernde Aufgabe, bei der Farbwörter wie blau oder rot in verschiedenen Farben geschrieben sind. Die Schwierigkeit besteht darin, die Farben der Wörter zu benennen, ohne die Farbwörter auszusprechen (Beispiel: rot blau grün weiss). Sie können eine Kurzfassung des Tests z.B. HIER selbst machen. Der Test ist übrigens völlig ungefährlich und in seiner Kurzfassung eher faszinierend als ermüdend.
„Nachdem wir diese mentale Aufgabe dazu benutzt hatten, die Selbstregulierungskapazität [sprich: die Willenskraft, d.Red.] der Teilnehmer zu schwächen, schafften sie es nicht mehr, das gleiche Sportprogramm durchzuziehen wie ihre Kollegen, die den Test nicht über längere Zeit bearbeitet hatten“ stellt Ginis fest. Je mehr Anstrengung sie in die Tests steckten, desto eher sagten sie Trainingstermine während der 8-wöchigen Studiendauer ab.
„Wir haben einfach ein begrenztes Maß an Willenskraft“ schließt Ginis, schiebt jedoch die gute Nachricht gleich nach:
„Ja, es gibt Strategien, geschwächte Willenskraft zu bekämpfen. Musik hören zum Beispiel oder – wie wir in einer unserer Studien gezeigt haben – feste Trainingspläne. Mit anderen Worten: Man muss sich selbst dazu verpflichten, zu trainieren. Unabhängig davon, was man tagsüber so tut einen festen Trainingstermin setzen und wahrnehmen.“
Unser Wille ist trainierbar.
Ginis sät sogar noch mehr Hoffnung: Wir können unsere Selbstregulierungskapazität dauerhaft erhöhen, wenn wir uns Trainingspläne machen. Oder uns zwingen, jede Nacht noch eine halbe Stunde extra zu lernen. Oder die letzte Viertelstunde Mittagspause zu kürzen, damit wir früher nach Hause gehen können. Oder immer wieder dem zweiten Stück Kuchen entsagen. „Willenskraft ist wie ein Muskel: Sie muss gefordert werden, damit sie gefördert wird“ behauptet Ginis.
gepostet i.A. von Dr Stephan Lermer
Quelle: McMaster University (2009, September 25). Rough Day At Work? You Won’t Feel Like Exercising.
Wann macht uns Arbeit glücklich?
Kaum ein Lebensinhalt weckt so gemischte Gefühle wie die Aktivität, mit der wir die zweitmeiste Zeit unseres Lebens verbringen: Arbeit.
Wann fühlen wir uns bei der Arbeit gut, empfinden dabei Stolz und Freude und können längerfristig Glück schöpfen? Der US-Glücksforscher Mihaly Csikszentmihaly hat diese Fragen zum Hauptinhalt seiner eigenen Forschungs-Arbeit gemacht. Und er lebt damit vor, was er in seinen Studien über das Verhältnis von Glück und Arbeit während der Jahre seines Schaffens herausgefunden hat.
- Arbeit macht uns dann glücklich, wenn wir fühlen, dass wir eine Mission haben, die wir mit unserer Arbeit verfolgen können. Fragen Sie sich einfach einmal: Welches gesellschaftliche Bedürfnis wird durch die Ergebnisse meiner Arbeit befriedigt (z.B. Kranke heilen, Gerechtigkeit gewährleisten, Wissen weitergeben, …)? Und: Warum sollte die Gesellschaft die Art von Arbeit, die ich tue, mit Status oder Privilegien belohnen? Vergegenwärtigen Sie sich also, welchen gesellschaftlichen Nutzen Ihre persönliche Arbeit hat.
- Ein guter Weg zum Glück im Job besteht darin, sich Vorbilder zu suchen, die „gute“ Arbeit leisten (‚gut‘ im Sinne von ’sinngebend‘ und ‚qualitativ hochwertig‘). So findet man nicht nur heraus, welche Art von Arbeit am besten zu einem passt, sondern auch, auf welche Art die eigene Arbeit am besten und am sinnvollsten gelingt. Fragen Sie sich also: Welche Kollegen werden ihrem Beruf oder ihrer Berufung am besten gerecht und warum? Und: Welche „Qualitätsnormen“ gibt es innerhalb meiner Berufssphäre?
- Wahrscheinlich am wichtigsten ist aber, ob man den eigenen Beruf und die damit verbundenen Tätigkeiten mit sich selbst moralisch vereinbaren kann. Fragen Sie sich deshalb: Bin ich auf mich und meine Arbeit stolz, wenn ich morgens in den Spiegel schaue? Würde ich in einer Welt leben wollen, in der sich jeder so verhält wie ich? Und: Welche moralischen Grenzen möchte ich in meiner Arbeit nicht überschreiten und warum?
Diese Fragen helfen, den eigenen Beruf und die damit verbundenen Tätigkeiten darauf hin zu untersuchen, ob man als Mensch und Person damit einverstanden ist. Lassen Sie sich dabei ruhig auch von Ihren Gefühlen leiten. Sie sind ein in persönlich wirklich wichtigen Dingen oft (aber nicht immer, siehe unsere Donnerstags-Reihe!) ein besserer Ratgeber als kühle Kalkulation. Und scheuen Sie nicht davor zurück, etwas neues zu wagen, wenn Sie ein besseres Gefühl dabei haben. Fragen Sie sich einmal ganz grundsätzlich: Wollen Sie wirklich einen Großteil Ihres Lebens mit etwas verbringen, das Sie nicht mit Ihren innersten moralischen Standards in Einklang bringen können?
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: http://www.goodworkproject.org/
Neues aus der Aufschieberitis-Forschung
Öhm..Entschuldigung, eigentlich wollten wir diesen Beitrag früher posten 😉
Es gibt Neuigkeiten aus der Forschung zur Prokrastination. Der auf dem Gebiet führende Wissenschaftler Dr. Piers Steel hat – nach nur 10 Jahren – ein umfangreiches Werk veröffentlicht, in dem er beschreibt und erklärt, warum und wie wir wichtige Dinge aufschieben. Seine wichtigsten Schlussfolgerungen:
- Die meisten Selbsthilferatgeber liegen falsch: Prokrastination ist nicht die Folge von Perfektionismus.
- Macht man zu Neujahr die besten Vorsätze, ist das meist zum Scheitern verurteilt.
- Das menschliche Aufschiebeverhalten ist mit einer einzigen mathematischen Formel beschreibbar.
Zunächst beschreibt Steel aber, was einen typischen „Aufschieber“ von einem gewissenhaften Menschen unterscheidet, der in der Regel seine Projekte pünktlich abschließt: „Aufschieber haben generell weniger Selbstvertrauen und speziell weniger Vertrauen darauf, dass sie die anfallenden Aufgaben auch tatsächlich bewältigen können.“ Die bisherige Vermutung, dass vor allem Perfektionisten die Dinge aufschieben, weil sie sich nicht sicher sind, dass ihre Projekte eigenen oder fremden Standards genügen, widerlegt er und behauptet statt dessen: „Perfektionisten schieben in Wahrheit weniger auf. Allerdings machen sie sich um das Aufschieben viel mehr Sorgen.“
Was sind aber die wahren Ursachen der Aufschieberitis? Steel zählt auf: Bedenken wegen der Aufgabe, Impulsivität, ein Hang zur (Selbst-)ablenkung, und Leistungsmotivation. Dabei bedeutet nicht jedes Aufschieben gleich (krankhafte) Prokrastination. Entscheidend ist, dass man glaubt, es wäre besser, nun anzufangen, aber trotzdem eben nicht anfängt.
Wenn Sie sich jetzt selbst ein wenig schuldig fühlen, sind Sie in guter Gesellschaft: Fast jeder Mensch durchlebt akute Phasen der Prokrastination, 15-20% der Bevölkerung sind chronische Aufschieber. Steel belegt, dass vor allem Impulsivität und das Vorhandensein von ablenkenden Aktivitäten Prokrastination begünstigen. Die Fernbedienung auf dem Tisch neben uns und die Kollegin, die sich so gerne zwischendurch mit uns unterhält sind wohl die besten Beispiele für Anreize, denen wir impulsiv nachgeben.
Die gute Nachricht: Willenskraft hilft enorm gegen impulsives Verhalten und selbstgewählte Ablenkung. „Ob man nun glaubt, dass man es schafft oder ob man es nicht glaubt – meist hat man recht. Und wenn man mehr Selbstkontrolle gewinnt, steigt zunächst die Erwartung, dass man es schafft, den Verlockungen und Ablenkungen der Umwelt zu widerstehen. Das wiederum verbessert die eigene Fähigkeit, die wichtigen Dinge gleich anzupacken“ weiß Steel.
Abschließend meint er mit einem Augenzwinkern: „Prokrastination greift gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten um sich. Deshalb: Forschungsbemühungen zur Prokrastination sollten gerade jetzt auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden.“
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Quelle: University of Calgary, 2009. We’re sorry this is late…Research into procrastination shows surprising findings
Bore-Out-Syndrom – Krank vor lauter Langeweile
in Kooperation mit news.de
 Zu viel Stress macht krank und kann zum Burnout-Syndrom führen. Doch auch zu wenig Anforderung und Langeweile im Job können das seelische Gleichgewicht ins Wanken bringen. Die Fachwelt spricht dann vom Bore-Out-Syndrom.
Zu viel Stress macht krank und kann zum Burnout-Syndrom führen. Doch auch zu wenig Anforderung und Langeweile im Job können das seelische Gleichgewicht ins Wanken bringen. Die Fachwelt spricht dann vom Bore-Out-Syndrom.
Das Bore-Out-Syndrom ist als Gegenstück zum Burnout-Syndrom zu verstehen. Die Symptome sind sich sehr ähnlich. Der Name leitet sich ab vom englischen Begriff «to bore», was so viel bedeutet wie «langweilen».
Der Mensch braucht ein angemessenes Maß an Abwechslung, Reizen und Herausforderungen, eben ein gesundes Maß an Stress, erklärt der Münchner Psychologe und Coach Dr. Stephan Lermer. Bekommt er zu viel davon oder zu wenig, dann kann dies zu Depressionen und anderen psychosomatischen Symptomen führen. So sei erwiesen, dass nach einem Passivurlaub, den man drei Wochen lang faulenzend am Pool verbringt, der Intelligenzquotient um 20 Punkte abfällt.
Arbeitnehmer, die an Bore-Out-Syndrom erkranken, fühlen sich durch Unterforderung gestresst.
Sie werden häufig als faul betrachtet, doch das ist nicht der Fall, betont Lermer. «Der will ja arbeiten», sagt der Glücksforscher, «bekommt aber nicht genügend herausfordernde Aufgaben.»
Freut sich der Betroffene im Büro anfangs noch über die wenige Arbeit und darüber, ungestraft im Internet surfen und anschließend in Ruhe Zeitung lesen zu können, wird ihm bald langweilig. «Doch kaum jemand gibt gerne zu, sich bei der Arbeit zu langweilen und im Umkehrschluss nicht gebraucht und somit nutzlos zu sein», sagt Lermer. Deshalb versuchen die Betroffenen anfangs, ihre fehlende Arbeit zu kaschieren. Etwa durch geschäftiges Tippen auf der Tastatur, sobald ein Kollege in der Nähe ist. Oder durch Verzögern der Aufgaben, die man längst hätte fertig haben können.
«Doch irgendwann kippt das um», sagt Lermer. Und zwar in Desinteresse. «Der Betroffene sieht sich dann als Opfer.» Etwa durch Fehler des Vorgesetzten oder der Geschäftsleitung. «Er merkt, dass ihm eine ganz wichtige Quelle an Anerkennung fehlt», erklärt Lermer den Mechanismus, der sich schnell zu einem Teufelskreis entwickelt.
Frauen finden schneller aus dem Teufelskreis
Dennoch werden die wenigsten Bore-Out-Betroffenen von sich aus aktiv und bitten ihre Vorgesetzten um neue oder herausfordernde Aufgaben. Grund dafür sei zum einen, dass in Deutschland Arbeit negativ besetzt ist und immer noch mit lästiger Maloche gleichgesetzt wird, ist Lermer überzeugt. Andererseits scheuen sich viele vor der Verantwortung, die eine größere Aufgabe mit sich bringen könnte. «Wer unterfordert ist, der kann auch nichts falsch machen und anschließend nicht schuld seien, wenn etwas schief läuft», so Lermer.
Hilfe und ein Erkennen der Problemursachen kommen meist erst von außen. Etwa von einem Hausarzt oder Psychologen, der wegen einer bereits vorhanden Depression aufgesucht wird. Oder von der Lebenspartnerin, die sich mit der Situation ihres Mannes auseinander setzt. Überhaupt sei das Bore-Out-Syndrom hauptsächlich ein Männerproblem. Frauen würden zumindest schneller wieder aus dem Teufelskreis herausfinden, vermutet Lermer. Grund: Sie kommunizieren ihre Probleme tendenziell viel stärker. «Aber Männer, die an Burnout leiden, erkennen dies ja auch nicht als Krankheit, sondern sehen darin, wie auch im Bore-Out, ein eigenes Versagen», gibt Lermer zu bedenken.
Ist die Ursache erkannt, lässt sich gegen die äußeren Umstände angehen, etwa durch ein Gespräch mit dem Vorgesetzten, dem Betriebsrat oder einer Vertrauensperson im Büro. Kehrt wieder Anerkennung durch gemeisterte Herausforderungen in den Berufsalltag ein, verbessert sich auch die Symptomatik. «Wir sind auf Herausforderung angelegt», so Lermer. «Bequemlichkeit ist kein Weg zum Glück.»
Text: news.de-Redakteurin Katharina Peter
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
„Zwei Dinge zur selben Zeit zu tun heißt, nichts zu tun“
Das wusste Publilius Syrus schon über 2000 Jahre bevor wir am Steuer telefonierend den Verkehrsfunk abhörten und gleichzeitig unsere Kinder sanft darauf hinwiesen, endlich ruhig zu sein.
Ganz so dramatisch ist es zwar nicht, aber das viel beschworene Multitasking ist kürzlich wieder etwas in Frage gestellt worden – durchStudien der renommierten Professoren David Meyer von der University of Michigan und Marcel Just von der Carnegie Mellon University.
Professor Meyer ließ seine Studenten verschiedene Kopfrechen-Aufgaben bearbeiten. Für eine Zeit lang sollten sie dabei nur dividieren, danach kamen Multiplikationsaufgabem, anschließend Subtraktion und Addition. Zwischen diesen ‚Blöcken‘, in denen jeweils nur eine Grundrechenart vorkam, befanden sich Serien von gemischten Aufgaben – das heißt, Meyer wechselte eine Zeit lang ständig die Aufgabenart (von Addition zu Division zu Subtraktion usw.). Bei diesen Wechseln brauchten die Studenten länger zur Lösung der Aufgaben: Durchschnittlich 1 Minute für 10 Multiplikationsaufgaben am Stück, aber 1 Minute und 20 Sekunden für gemischte Multiplikations- und Divisionsaufgaben von gleicher Schwierigkeit.
Interessant wurde es im zweiten Teil des Experiments: Professor Just benutzte fMRI (funktionelle Magnetresonanztomographie), um den Gehirnen seiner Probanden beim Arbeiten zuzusehen. Er zeigte ihnen komplizierte Sätze, während sie gleichzeitig geometrische Objekte mental rotieren lassen mussten – beispielsweise einen Würfel in Gedanken um mehrere Achsen drehen. Das Verstehen komplizierter Sätze und das Rotieren komplizierter Objekte beanspruchen verschiedene Hirnareale. Und so ging Just eigentlich davon aus, dass sich die beiden Aufgaben nicht gegenseitig behindern, oder zumindest: Jedes der beiden Hirnareale sollte härter arbeiten und insgesamt sollte die Anstrengung zunehmen.
Das überraschende Ergebnis: Die Hirnareale fürs Verstehen und Rotieren arbeiteten beide ineffizienter, wenn sie gemeinsam gebraucht wurden. Fazit: weniger Brainpower für jede einzelne Aufgabe bei Multitasking!
Die gute Nachricht: Multitasking ist trainierbar. Professor Meyer hat Trainingsstudien durchgeführt, die demonstrieren, dass man mit einiger Übung ein oder mehrere simultane Tätigkeiten soweit routinieren kann, dass weniger Ressourcen dafür notwendig sind. Meyer betont allerdings: „Man kommt relativ schnell an die Grenzen der Trainingseffekte.“ Sein Rat deshalb: „Wenn Sie es vermeiden können: Multitasken Sie nicht.“
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer
Monday, Monday?
Every other day, every other day,
Every other day of the week is fine, yeah
But whenever [Wednesday] comes, but whenever [Wednesday] comes
You can find me cryin‘ all of the time
Forscher der Universität Vermont wollen herausgefunden haben, dass der Mittwoch der unbeliebteste Wochentag ist – zumindest im Internet. Peter Dodds und Christopher Danforth hatten über vier Jahre 2,4 Millionen Blogeinträge untersucht, so die britische Tageszeitung „Daily Mail“.
Die Mathematiker hatten dabei auf die Häufigkeit geachtet, mit der bestimmte Wörter verwendet wurden. So waren an Mittwochen die meisten negativen Wörter wie „Trauma“, „Beerdigung“ oder „Selbstmord“, an Montagen hingegen hauptsächlich positive Wörter wie „erfolgreich“, „Paradies“ oder „Liebe“ verwendet worden.
Die Erinnerung an das vergangene Wochenende mache den Montag zum zweitglücklichsten Tag der Woche, während der Sonntag angeblich der allerbeliebteste Wochentag ist.
Die Studie hat weiterhin festgestellt, dass in den letzten vier Jahren der 4. November 2008, der Tag an dem Barack Obama zum Präsidenten der USA gewählt worden war, der Glücklichste für Internetblogger war. Und dass die glücklichsten Internetnutzer zwischen 45 und 60 Jahren alt sind.
gepostet i.A. von Dr. Stephan Lermer